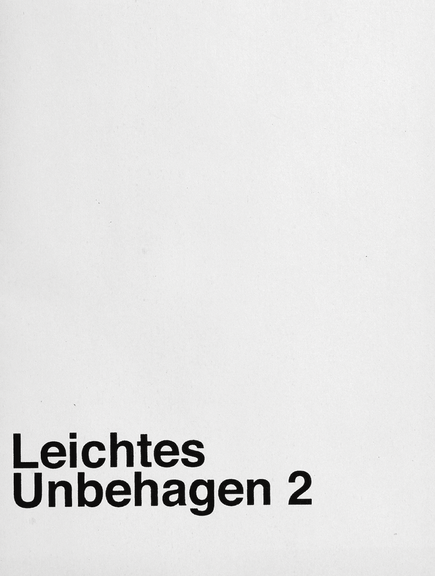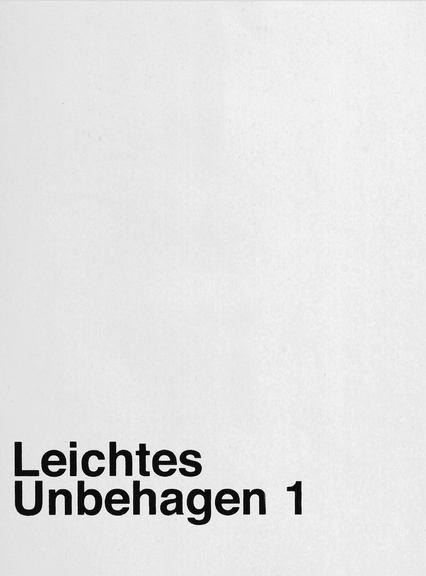Cord Riechelmann beschäftigt sich als Biologe und Philosoph empirisch und theoretisch mit Tieren. Er hat mehrere bioakustische Tondokumente zu den Stimmen der Tiere Europas, Asiens und Afrikas (2008) herausgegeben, zahlreiche Bücher wie Wilde Tiere in der Großstadt (2004), Krähen: Ein Portrait (2013) oder Vögel: Vom Singen, Balzen und Fliegen (2022) veröffentlicht und schreibt seit sieben Jahren eine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu „Lebewesen der Woche“. In seinem neuesten Buch Leichtes Unbehagen. Von Menschen und anderen Tieren (2023) treten seine Tierporträts mit den Arbeiten Rosemarie Trockels in einen Dialog.
Pascal Jurt: Die landläufige Meinung besteht darin, es gehe beim Zuhören darum, dem*der Anderen Gehör zu schenken. Sie sehen Tiere als Teil der Gesellschaft, nicht als das Andere. Im Vorwort des Künstlerinnenbuchs mit Rosemarie Trockel erwähnen Sie Gilles Deleuzes Liebe zu den Tieren. Der französische Philosoph erklärte dies damit, dass Tiere fortlaufend Zeichen in die Welt senden würden, ohne eine*n gleich mit Kommunikation zu belästigen. Was könnte das für eine „Kunst des Hörens/Zuhörens“ bedeuten?
Cord Riechelmann: Es hat sehr lange gedauert, bis das Zuhören überhaupt als aktiver Prozess begriffen wurde. Das hat etwas mit dem alten, auch biologischen Verständnis der Männer als aktive Gestalter und der Frauen als passive Gefäße zur Reproduktion zu tun. Bei den meisten Singvögeln singen die Männchen, und die Weibchen hören zu, also untersuchte man vor allem die Sänger und ihren Gesang. Deleuze und Guattari gehören zu den Ersten, die im Ritornell-Kapitel in Tausend Plateaus zwei Umdeutungen an den Territorialzeichen der Tiere – seien es Töne oder Farben – vornehmen. Sie begreifen sie zum einen als Kunst, als schöpferischen Akt, der parallel und nicht als Vorläufer zu unseren Kunstproduktionen existiert. Zum anderen übersetzen sie die gesendeten Zeichen nicht, gehen aber von einem Ohr oder Auge aus, an das sie gesendet werden, und dieses Ohr oder Auge wählt die Zeichen, die ihm gefallen. Und das tut das empfangende Ohr oder Auge allein auf Basis der Qualität der Zeichen, die an keine Funktion wie gute Gene, großes Revier oder etwas anderes Nützliches gekoppelt sind. Es ist reine Zeichenwahl, und darin waren sie fast prophetisch, denn das ist der neueste Stand der Forschung: Die Weibchen wählen allein auf der Basis der Kompositionskünste der Sänger, und das ist ein aktiver Prozess von gestalterischer Bedeutung.
Jurt: Stammt die eher untergeordnete Rolle des Zuhörens aus der Tierwelt?
Riechelmann: Sie kommt aus der Anthropologie des frühen 20. Jahrhunderts und kann formelhaft in der These „Man – the Hunter“ und „Woman – the Gatherer“ zusammengefasst werden. Von dieser Anthropologie wanderte sie in die Primatologie, die im Wesentlichen als Folge des Ersten Weltkriegs in den USA entstand. Robert Yerkes, einer der Begründer der Tierpsychologie, war mit dem Eintritt der USA in den Krieg zu einem der psychologischen Berater der Army geworden. In den Vereinigten Staaten wurden, im Unterschied zu Deutschland, zum Beispiel die psychischen Kriegsfolgen wie Depressionen und Psychosen als gesellschaftliches Problem begriffen. Und Yerkes war auf der Suche nach einem Tiermodell für die menschlichen Psychosen, als er Anfang der 1920er-Jahre zwei Schimpansen von einem Seemann im Hafen von Boston kaufte, was als Beginn der modernen Primatologie gelten kann. Als Modell für Psychosen schieden die beiden Affen schnell aus. Mit ihnen entwickelte Yerkes aber Grundzüge einer Psychologie der Affen, die allein auf seiner Konzentration auf Männer basierte. Die Affenfrauen waren nur Beiwerk, sie gestalteten das Soziale nicht.
Jurt: Wann kam es zum Wandel dieser Sichtweise?
Riechelmann: Das änderte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar dadurch, dass die überwiegende Mehrheit der Student*innen der Primatologie Frauen waren. Und die machten die Primatologie über die 1960er- und 1970er-Jahre zu einer der ersten Wissenschaften, die nicht nur überwiegend von Frauen betrieben wurde, sondern auch zu einer, in der die wichtigsten Positionen institutionell von Frauen besetzt waren. Dadurch kamen die Frauen in den Blick, und die Geschichten mussten wirklich umgeschrieben werden. Donna Haraway erzählt in ihrem Hauptwerk Primate Visions (1989) die Geschichte dieser Wissenschaft wünschenswert detailliert. Ganz ähnlich, nur zeitlich später, verlief die Forschung zum Vogelgesang. Auch dort waren es mit der Zunahme des Frauenanteils in der Wissenschaft Frauen, die erstmals experimentell den Blick auf die zuhörenden weiblichen Vögel richteten. Erstaunlich ist das unter anderem deshalb, weil die wählenden Weibchen, die mit ihrer Wahl zu aktiven Gestalterinnen der männlichen Körper werden, indem sie bestimmte Formen wie komplizierten Gesang oder lange, bunte Federn bevorzugen, bereits am Anfang des Nachdenkens über das, was Charles Darwin die sexuelle Selektion nannte, standen. Für Darwin war es keine Frage, dass es die Weibchen waren, die im Prozess der Partner*innenwahl bestimmten, wer zu wählen sei, und nicht die Männchen. Das Zuhören ist in diesem Prozess der Part, der die Unterschiede in der Produktion wahrnimmt. Was aber natürlich nicht ausschließt, dass sich ein Sänger auch an seinem eigenen Gesang berauschen kann. Die Lust am eigenen Gesang dürfte immer noch ein nicht unwesentlicher Motor für die teilweise exorbitanten Zeichenproduktionen von Tieren sein.
Jurt: In der Philosophie des 19. Jahrhunderts wollte zum Beispiel Hegel dem Zauber des Gesangs der Sirenen, dem Zauber der Stimme des Anderen, nicht erliegen. Verkannte er, dass der Produktion durch die Stimme eine Rezeption durch das Ohr entspricht?
Riechelmann: Hegel ist komplizierter. Der junge Hegel unterscheidet die Vögel von anderen Tieren, „weil sie den Gesang haben, den die anderen entbehren, weil sie dem Element der Luft angehören – artikulierende Stimme“ und ein aufgelösteres Selbst hätten. Er redet auch vom „tätigen Gehör“, das reines Selbst sei und sich als Allgemeines setzt. Nur hört das alles mit seiner Konzentration auf das Selbstbewusstsein auf. Das hatten ja nur Menschen.
Jurt: Wann rücken Aspekte des Sprechens und des Zuhörens in den Hintergrund und der Logos wird zunehmend mit der Schrift in Verbindung gebracht?
Riechelmann: Das ist schwer nachzuvollziehen. Für Aristoteles hatten Nachtigallen zum Beispiel Schulen. Er hatte den bis heute gültigen Zusammenhang zwischen dem, was junge Vögel hören und als Alte dann singen, richtig und in seiner didaktischen Dimension erkannt. Was sie nie gehört hatten, konnten sie auch nicht nachsingen oder neu kombinieren. Er redet auch von „Wörtern“, die die Vögel produzieren. Irgendwann aber siegte die Schrift über alles. Sie galt der Stimme als überlegen, und dann hörte die Beschäftigung mit der Stimme auf, bis die strukturale Linguistik sie wieder in den Blick nahm. Und in der Folge erkannte man auch die tiefen Analogien zwischen unserem Sprachlernen und dem Gesangslernen der Vögel. Vom Hören zum Sound sozusagen.
Jurt: Georg Simmel trifft in seinem Aufsatz „Soziologie der Sinne“ (1907) eine Unterscheidung oder gar Hierarchisierung zwischen Ohr und Auge: Er bezeichnet das Ohr als das schlechthin egoistische Organ. Ist das eine neue Beobachtung?
Riechelmann: Ja – und zwar dadurch, dass er das Ohr in direktem Kontrast zum Auge setzte, und das in einer Zeit, als die Bilder begannen, die menschlichen Sinne zu überschwemmen. Simmel lebte zwar noch nicht in der Zeit der Okulartyrannis, in der die unendlichen Bildproduktionen alle anderen Sinne erdrücken, er hatte aber ein Gespür dafür, dass eine Verschiebung vom Ohr zum Auge sich anbahnte. Wenn man so will, ist sein egoistisches Organ so etwas wie die Rettung des einzelnen Selbst vor den Bildern der Welt.
Jurt: Sie betonen, dass man die Natur-Kultur-Differenz schon lange nicht mehr aufrechterhalten kann. Die Biolog*innen oder Ornitholog*innen sind nicht nur teilnehmende Beobachter*innen, nicht nur Hörende, sondern auch Sehende, zudem oft Akteur*innen oder eher Adressat*innen. Bei bestimmten Vögeln sind die zuhörenden Weibchen inzwischen so kritisch geworden, dass die Männchen sich ihren Beifall mehr und mehr von Stadtmenschen holen.
Riechelmann: Die Natur-Kultur-Differenz ist in ihren alten Schemen wie die Mensch-Tiere-Differenz sicherlich zusammengebrochen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es da nicht weiterhin Unterschiede gibt. So wie Elstern, auch wenn sie sich im Spiegel erkennen, Werkzeuge herstellen und vorausschauend denken können, immer noch keine Menschen, sondern Elstern sind, bleibt auch die Natur existent. Man muss sie nur völlig neu als eine Natur nach der Natur verstehen lernen, und das ganz analog zum alten, abendländisch-europäischen Universalismusbegriff. So wie man einen Universalismus nach dem Universalismus erst noch schaffen muss, muss auch die Natur völlig neu verstanden werden, und zwar schon deshalb, weil die Kulturalisierung von allem und jedem nur eine neue Sackgasse wäre.
Jurt: Die Frage des Umgangs mit sogenannten Minderheiten, also denjenigen, die nicht ge- oder erhört werden, wird meistens von der Ebene des Empowerments her gesehen, also von der Frage des Stimmeerhebens. In jüngster Zeit geht es aber auch um diejenigen, die nicht zu einer Wahl, zu einer Entscheidung zugelassen sind, wie Dinge, Pflanzen und Tiere, die aber gehört und auch gesehen werden müssten. Wie kann das (Zu-)Hören der Stimmen der Tiere zu einer Verschiebung führen, die nicht nur auf das Wortergreifen zielt?
Riechelmann: Ganz platt, indem man es als aktiven Prozess versteht, der immer schon gestalterisch wirkte. Was man hört, was in den Körper eindringt bzw. man eindringen lässt – auch diese Filter sind nicht nur unbewusst oder unwillkürlich –, zeitigt Wirkungen im Körper. Ob ich eine Widerrede oder einen mir ganz fremden Ton zulasse oder nicht, verändert das Selbst oder eben nicht. Es sind Fragen nach der Empfindlichkeit gegenüber den angesprochenen Dingen, Pflanzen und Tieren, die man zulässt, bevor man in sich zurückkehrt. Ganz allgemein: Fragen nach der Gleichheit.
Jurt: Als erstes Land verankerte Ecuador 2008 Naturrechte als „Derechos de la naturaleza“ in einer Verfassung. Wie könnte ein anwaltschaftliches Verhältnis oder ein „Allyship“ zu bzw. mit Tieren konkret aussehen? Wie könnte ein „donner la parole au peuple“, zu dem die Tiere auch gehören, funktionieren?
Riechelmann: Indem man den Tieren eine „Klagebefugnis“ zugesteht, wie es im Recht heißt. Eine Befugnis, die Michel Serres auch für den Golf von Mexiko, Flüsse und andere durch Menschen gepeinigte Landstriche forderte. Wobei die Basis dieser Befugnis eben die Fähigkeiten und Ansprüche der jeweiligen Tierformen und ihrer Individuen sein müssten, die nicht von uns ausgeht, also nicht danach fragt, ob uns die Tiere ähnlich sind, sondern fragt, was die Tiere brauchen und wollen.
Jurt: Friedrich Kittler weist in seiner Vorlesung Optische Medien (1999) auf Marshall McLuhans These hin, die behauptet, dass unter audiovisuellen Bedingungen unsere Augen, Ohren, Hände gar nicht mehr unseren Körpern gehören, geschweige denn den Subjekten, die in der philosophischen Theorie als Herren der Körper figurierten, sondern den Fernsehanstalten, an die sie angeschlossen sind. Gehören die Ohren und die Augen heute dem Smartphone als Prothese körperlicher Organe? Welche Konsequenzen hat das?
Riechelmann: Na ja, wer heute noch glaubt, er sei der Herr über seinen Körper, dem kann man nur viel Spaß in seinem Glauben wünschen. Und dass Medien uns auch enteignen, mag so sein, aber sie sind erst einmal auch eine Organverlagerung. Jeder Gedächtnisspeicher, den ich außerhalb meines Selbst irgendwo ablegen kann, ist auch eine Entlastung. Das muss ich nicht mit mir rumschleppen. Eine andere Frage ist aber, welche Medien mir als Speicher dienen und ob sie nicht mit mir etwas machen, das ich nicht unbedingt will. Aber davon habe ich keine Ahnung, dazu verstehe ich zu wenig von meinem Smartphone.