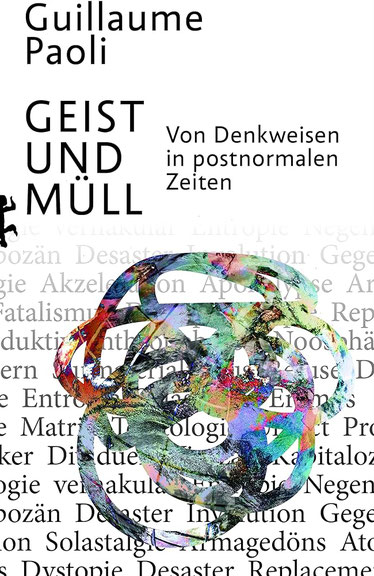Wir leben seit Langem schon, und die Jüngeren können es sich eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen, in äußerst herausfordernden Zeiten, da eine Krise gewissermaßen die nächste gebiert, so als hätte, um das neue Säkulum auf ganz besonders maliziöse Weise zu würdigen, Pandora ihre Büchse einfach noch einmal über unseren Köpfen entleert. Wir werden also seit einem knappen Vierteljahrhundert, mit 9/11 als unrühmlichem Beginn, pausenlos in Atem gehalten. Nach dem Terror dann: der Euro, die Flüchtlinge, das Coronavirus, der Ukraine-Krieg (mit Energieknappheit und Inflation als unschönem Nachschlag). Und als wäre das nicht genug, dräut, um die atmosphärische Eintrübung vollkommen zu machen, hinter oder vielmehr über all dem auch noch die Klimakrise. Doch halt! Trifft dieses alliterationsschwangere Kompositum den besorglichen Ernst der Lage wirklich? Nein, meint der in Frankreich geborene, in Berlin lebende und auf Deutsch publizierende Schriftsteller Guillaume Paoli dazu und wendet ein, dass der Begriff der Krise – ebenso wie der der Katastrophe – für etwas lediglich Disruptives steht, für eine vorübergehende, weil letztlich behebbare Störung eines ansonsten nahezu friktionsfrei funktionierenden Systems: ein, wie er gleich am Anfang des Buchs verdeutlicht, erstes und überaus bezeichnendes Symptom einer Verkennung und recht eigentlich Verharmlosung der wahren Bedrohung, der wir uns mittlerweile ausgesetzt sehen. Und diese umfasst mit dem dramatischen, wiewohl allgemein eher unbeachteten Artensterben, der ungebremsten Abholzung etwa des Regenwalds oder der herannahenden Verknappung des Trinkwassers, um das Schreckensszenario wenigstens in Ansätzen auszumalen, weit mehr als das kontinuierliche und sommers buchstäblich schweißtreibende Ansteigen der Temperaturen.
Paoli möchte diese unheilvolle Gemengelage daher viel lieber mit dem Begriff des Desasters umschrieben wissen, einem Terminus, der unspezifisch bzw. dehnbar genug ist, um einerseits zum Ausdruck zu bringen, dass eine Rückkehr zum Status quo ante nunmehr ausgeschlossen ist; andererseits lässt der Begriff jedoch auch unverhohlen erkennen, dass der Worst Case, nämlich die (Selbst-)Auslöschung der Menschheit, zumindest möglich erscheint, sollte sich nichts Grundlegendes ändern. Demzufolge wäre der Menschheit zum zweiten Mal in ihrer Geschichte – nach der historischen Zäsur von Hiroshima und Nagasaki – nur noch eine Frist gewährt, die die Selbstverständlichkeit des Weiterbestands der Welt ernstlich in Zweifel zieht: eine Frist, die es im Gegensatz zur alten thermonuklearen Bedrohung, die durch Putins wiederholte atomare Winke indes gerade auf erschreckende Weise reaktualisiert wird, aber auch zu gestalten gilt, anstatt sie nur zu erstrecken. Womit wir beim wirklich Entscheidenden angelangt wären, also der – horribile dictu – Systemfrage, die Paoli jedoch mit unbeirrbarer Nachdrücklichkeit stellt. Auf der abschüssigen Bahn in Richtung Abgrund, die wir – Stichwort: fehlende ökonomische Systemalternativen – alle zusammen eingeschlagen haben, würde nämlich eine wohlfeile Reform der wesentlich auf Vernutzung und Raubbau gründenden kapitalistischen Wirtschaftsweise nicht mehr genügen. Genau darum wäre auch mit der viel zitierten – und unverbrüchlich marktgerechten! – grünen Wende (außer Profiten und Renditen) nicht viel zu gewinnen, weil dabei übersehen würde, dass für die Speicherung und Weiterleitung der erneuerbaren, aber mitnichten sauberen Energien Abermillionen Tonnen Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Kobalt sowie weitere seltene Rohstoffe erforderlich wären, deren Vorkommen sich alle auf den globalen Süden konzentrieren. Weshalb für die Menschen dort der Green New Deal vor allem einmal mit einem Mehr an gigantischen Bergwerken, toxischen Abfallhalden oder verunreinigten Wasserreservoirs einherginge, sodass sich der grüne Anstrich, den sich der Kapitalismus 2.0 in diesen Tagen zu geben sucht, letztlich als bloße Augenwischerei erweist.
Die Rettung aus dieser Misere, an der die Kurzsichtigkeit der Konzerne, die Willfährigkeit der Politik und die Konformität der (medialen) Öffentlichkeit alle ihren gerechten Anteil haben, bestünde für Paoli mithin einzig, und er schämt sich dieser Wortwahl durchaus nicht, in einer Revolution; nur um im selben Moment einzugestehen, sich keine rechte Vorstellung davon machen zu können, wie sich eine solche eigentlich anbahnen könnte. Denn die meisten von uns üben sich weiterhin im business as usual, indem sie die anthropogene Erderwärmung und die mit ihr Einzug haltende Apokalyptik schlichtweg leugnen; oder ihre hellsichtigeren Zeitgenoss*innen, die die bequeme Wohleingerichtetheit der modernen Welt mitunter renitent in Zweifel stellen, als hysterische Kassandras – neudeutsch: Klimakleber*innen – anprangern; oder überhaupt kein genuines Interesse für künftige – einschließlich „Letzter“ – Generationen aufbringen wollen (man denke dabei an Max Frischs Eingangsfrage seines berühmten Fragebogen), implizieren solche Ausblicke doch schließlich immer auch schmerzlich die eigene Endlichkeit.
Und das vielleicht Schlimmste daran: Unser fataler Irrweg müsste eigentlich schon längst als erkannt gelten, seit 1972 der wahre Schockwellen auslösende Bericht des Club of Rome erschien, der ja bereits in seinem Titel die „Grenzen des Wachstums“ anmahnte und, im Falle von deren Ignoranz, den Zusammenbruch der industriellen Zivilisation vorhersagte. Ein halbes Jahrhundert später haben wir für uns aber offenkundig noch immer nicht die richtigen Umkehrlehren daraus gezogen – und auch alle weiteren wissenschaftlichen Warnungen seitdem leichtfertig in den Wind geschlagen. Womöglich ist also gerade der Umweltschaden wirklich derjenige, der nicht klug macht.