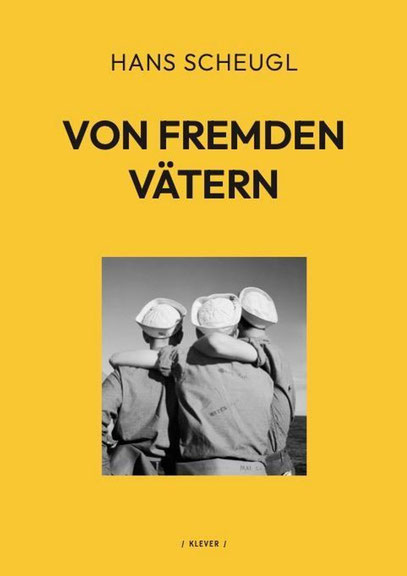Hans Scheugl, Jahrgang 1940, Autor, Filmemacher, Fotograf und bedeutender Chronist der österreichischen Filmavantgarde, blickt in Von fremden Vätern auf sein Leben zurück und scheut sich nicht, intime Details preiszugeben. Zwei Wünsche stecken hinter diesem Unterfangen: „Der eine will die ganze Sache einfach loswerden, der andere will mit ihr fertigwerden, um an ihr Ende zu kommen, auch wenn es ein Ende nicht geben wird.“ Im ersten, autobiografischen Teil gibt Scheugl Auskunft über seine teils schmerzlichen Erfahrungen, die seiner Homosexualität geschuldet sind, sowie über seinen Werdegang als Künstler; der zweite, kürzere Teil beinhaltet luzide Essays zu Männerliebe und Männerfreundschaft.
Der wichtigste Mensch in seinem Leben ist Scheugls Vater, der 1944 an der Ostfront fiel. Erinnerungen an ihn existieren kaum, da ihn der Sohn nur während kurzer Fronturlaube zu Gesicht bekam. Was zurückblieb, sind Feldpostbriefe des Vaters, sein Wehrpass, Fotos und ein Taschenkalender. Anhand dieser materiellen Überbleibsel versucht Scheugl, ein Bild des Vaters zu rekonstruieren, den er als maskulin und elegant imaginiert. Beim Schreiben erkennt er jedoch, dass der Vater lediglich als „Sprachbild“ vergegenwärtigt werden kann. Gefühle verbinden sich mit diesen Erinnerungen keine mehr, wie der Autor nüchtern feststellt. Doch mitunter verrät sich das Unbewusste. In einem Brief, unmittelbar nach einem Fronturlaub verfasst, schreibt der Vater, er hätte zum Abschied so gerne noch ein „Schlatzbussi“ von seinem Sohn haben wollen. Dieses vulgäre Wort („Schlatz“ bezeichnet Schleim, Speichel), das die Mutter zu „Schleckerbussi“ verharmlost, liest der Sohn als Botschaft zwischen Liebenden: „Ich habe es wie ein kleines stummes Alien aus dem Briefkuvert geholt [...]. Es hat meine DNA. [...] Ich möchte es unter einen Glassturz stellen, damit niemand daran rührt.“
Nach dem Tod des Vaters nimmt seine alleinerziehende und berufstätige Mutter die bestimmende Rolle in seinem Leben ein. Als Kleinkind kleidet sie ihn als Mädchen. Bei der Beschreibung eines Fotos, das den Dreijährigen zeigt, schlägt die Icherzählung unvermittelt in die dritte Person um: „Auf den Fotos von Karlsruhe trägt er eine Haarrolle, die von einer Spange am Kopf zusammengehalten ist.“ Ein ähnlich abrupter Wechsel von der Ich- zur Er-Perspektive findet sich in der Schilderung der ersten homosexuellen Begegnung. Der 13-Jährige folgt im Schwimmbad einem Unbekannten auf eine abgelegene Toilette, wo die ersehnte „Erlösung“ auf ihn zu warten scheint. Der Rückgriff auf das Er mutet wie eine Distanzierung an, einmal gegenüber der unverzeihlichen mütterlichen Umdeutung seines Geschlechts, zum anderen gegenüber seinem jugendlichen Ich, das voller Schuldgefühle ob des verwirrten Verlangens ist. Scheugl nutzt ein „Aufschreibbuch“, in das er die kleinen Freuden des Alltags in Klarschrift („mit Mutti im Kino“), seine sexuellen Aktivitäten hingegen in geheimnisvollen Signets vermerkt. Das Doppelleben, zu dem ihn sein Schwulsein im Wien der Nachkriegsjahre zwang, ist riskant, stand Homosexualität doch bis in die 1970er-Jahre in Österreich unter Verdikt.
Mit Kunst in Berührung kam Scheugl 1956 durch das „Atelier“ eines älteren Schulfreunds, das eine Enklave abseits des kleinbürgerlichen Elternhauses bot. Im selben Jahr begann eine intensive Auseinandersetzung mit Literatur, Psychoanalyse, Film und Fotografie, der auch erste Schreibversuche folgten. An der Wiener Filmakademie lernte er Ernst Schmidt kennen, mit dem er das heute legendäre Lexikon des Avantgarde-, Experimental- und Undergroundfilms (1974) verfasste. Gelegenheit zur Befreiung aus der Enge seiner Lebenswelt, in welcher „Hitl.“ (Hitler) seine geistigen Spuren hinterlassen hatte, boten Kommunen- und Drogenerfahrungen, vor allem aber ausgedehnte Reisen, wofür exemplarisch die Stationen Paris, Tanger, Kalkutta und New York stehen. Scheugl unterbrach damals seine Karriere im Umfeld des „Wiener Experimentalfilms“ der späten 1960er-Jahre und trat erst ab 1985 wieder als Filmemacher in Erscheinung.
Breiten Raum gewährt Scheugl sowohl den bedeutenden Liebesbeziehungen als auch unbedeutenden sexuellen Abenteuern. Bisweilen mit Foto versehen zeugen die Erinnerungen an Harold, Boris, Bill, Nassib, Joop, Lothar, Eric, Gianni, Michael und zahlreiche Unbenannte von einer selten erfüllenden, meist aber mühsamen Suche nach einer Liebe, deren Ideal der verlorene Vater ist. Scheugl bevorzugt betont männliche Partner, wobei sein eigener Part außer Zweifel steht: „Mich ficken zu lassen, käme nicht in Frage, so viel an Hingabe wäre Kapitulation.“
Im zweiten Teil des Buchs vollzieht Scheugl einen Perspektivwechsel. Sorgfältig recherchiert präsentiert er Konzepte männlicher Identität vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Der erste Essay widmet sich der Familie des Dichters Richard Beer-Hofmann, die ihre Wiener Villa 1939 verlassen musste. Dieser Ausflug in das jüdische Bürgertum ist autobiografisch motiviert, war die Villa doch zugleich Begegnungsort mit seinem Freund Harold und, Jahre später, Schauplatz einer Szene seines ersten Films Miliz in der Früh (1966). Sodann diskutiert Scheugl Formen von gleichgeschlechtlicher Freundschaft und Liebe, wobei er das körperbezogene 18. Jahrhundert, in dem Freunde einander nach Herzenslust umarmten und küssten, mit dem körperfeindlichen 19. Jahrhundert kontrastiert. Das letzte Kapitel ist mit „dad4son“ (Dad for Son) überschrieben und gewährt Einblick in die gegenwärtige Schwulenkultur, wo „Dad“ einen reifen Homosexuellen bezeichnet. Mit diesem Griff in die Schublade des homophilen Slangs kratzt Scheugl am bislang so makellosen Bild des Soldatenvaters und deutet augenzwinkernd ein Happy End an, was „Hitl.“ vermutlich gar nicht gefallen hätte.