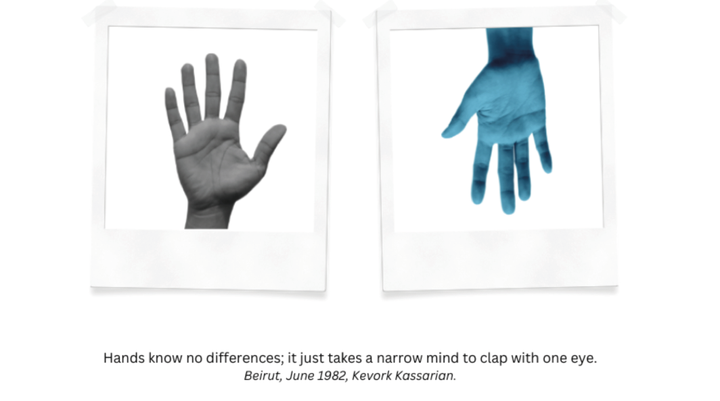Heft 2/2024 - Kulturkämpfe
Widerstand gegen eine katastrophale „Retrotopie“
Über Kulturkämpfe und den Aufstieg der rechtsextremen Ideologie
Ist es nur historischer Zufall, dass rechtsextreme Bewegungen immer dann Aufwind haben, wenn der öffentliche Diskurs von einer Art „Kulturkampf“ beherrscht wird? Dies war in der Zeit zwischen den Weltkriegen in Europa der Fall, auch wenn der Begriff „Kulturkampf“ selten verwendet wurde, um die damaligen soziopolitischen Gegebenheiten zu beschreiben, die letztlich zum Zweiten Weltkrieg und zur größten menschengemachten Katastrophe in der Geschichte führten. „Kulturkämpfe“ begleiteten auch die Entstehung der rechten evangelikalen Bewegungen in den USA in der Reagan-Ära der 1980er-Jahre; ihr Ziel war es, die Fortschritte bei den Bürgerrechten und der racial justice in den späten 1960er- und 1970er-Jahren rückgängig zu machen. Und sie finden aktuell statt, auch hier einhergehend mit der zunehmenden Beliebtheit rechtsextremer Bewegungen in Europa. Erkennt man den historischen Zusammenhang zwischen „Kulturkämpfen“ und dem Aufstieg rechtsextremer Politik, könnte man zu Recht vermuten, dass Erstere eine Manifestation von Letzterer sind; der Ausdruck dafür, dass diese tatsächlich existiert.
Umgekehrt könnten „Kulturkämpfe“ auch als spezifische Erscheinungsform der extremen Rechten auf der politischen Bühne betrachtet werden, wo sie als ausgrenzende Kraft auftreten. Deutlich wird dies, wenn man die verschiedenen Fronten untersucht, an denen die rechtsextremen Kulturkrieger*innen ihre Kämpfe austragen, sei es gegen LGBTQ+-Communitys, religiöse und ethnische Minderheiten, Frauen, Flüchtlinge oder andere marginalisierte Gruppen. Es scheint offensichtlich, dass all diese Fronten eines gemeinsamen haben: Sie sind Gegenstand des ausgrenzenden, frauen- und fremdenfeindlichen bzw. rassistischen politischen Projekts der extremen Rechten, das von dem nostalgischen Wunsch angetrieben wird, die weiße Vorherrschaft auf Kosten der geschlechtlichen, racial, ethnischen und religiösen Vielfalt wiederherzustellen. Heißt das, dass es gar keine „Kulturkämpfe“ gibt?
Nein, natürlich gibt es sie, und ihre Komponenten sind unbestreitbar. Betrachtet man diese unterschiedlichen, von rechten Krieger*innen geführten „kulturellen Scharmützel“ jedoch nur als „Kulturkämpfe“, übersieht man, welche umfassendere politische Dynamik hier im Spiel ist. Dieser Ansatz verkennt die Zusammenhänge zwischen scheinbar disparaten Kämpfen um vermeintlich kulturelle Angelegenheiten und benennt das Ganze deshalb nach einer seiner Erscheinungsformen. Darüber hinaus ist die Darstellung des Kampfes der extremen Rechten gegen die Rechte von Frauen, LGBTQ+, Flüchtlingen, Schwarzen und anderen marginalisierten Gruppen als rein kulturelles Problem auch in anderer Hinsicht problematisch, da eine derartige Haltung von einer besorgniserregenden Übernahme der rechtsextremen Perspektive zeugt.
Durch das unhinterfragte Akzeptieren der Vorstellung vom „Kulturkampf“ trägt man zur Entpolitisierung des neofaschistischen Aufschwungs bei, der als bloßer Kulturkonservatismus abgetan wird. Dadurch werden nicht nur die gefährlichen Ideologien, die hier am Werk sind, verharmlost, auch die drohende Gefahr einer potenziellen Katastrophe wird heruntergespielt: das Wiedererstarken der Rechtsextremen in Europa. Indem wir diese katastrophale Möglichkeit hinter Euphemismen verbergen, verschleiern wir die Ernsthaftigkeit der Lage und geben einer zukünftigen Katastrophe so einen relativ „netten“ Namen! Wie gefährlich die „Kulturkämpfe“ auch erscheinen mögen, sie werden immer weniger bedrohlich wirken als die eigentlichen Kämpfe oder die mögliche Katastrophe, dass die extreme Rechte die Kontrolle über unser Leben erlangt. Es handelt sich bei dieser vermeintlich rein sprachlichen Auseinandersetzung tatsächlich also um eine politische Bezeichnung.
Ohne eine klare Sprache, die der Komplexität der Sache gerecht wird, besteht die Gefahr, einen Scheinkrieg zu führen und das eigentliche Anliegen zu übersehen: nämlich zu verhindern, dass die extreme Rechte ein weiteres Mal an die Macht gelangt. Wie wir auf etwas reagieren, hängt davon ab, als was wir die Herausforderung verstehen, um die es geht. Wenn wir diese Kämpfe auf ihre eigene Weise angehen, ohne das gesamte politische Projekt ihrer rechtsextremen Krieger*innen zu verstehen, werden wir uns in identitären Minderheiten aus Schwarzen, Frauen, Flüchtlingen, LGBTQ+ verlieren, die jede für sich, separat voneinander existiert. Solange wir diese politische Dimension hinter den „Kulturkämpfen“ nicht verstehen, lässt sich auch nicht herausfinden, wie sich die Fülle an Minderheiten im Visier der extremen Rechten in eine politische Mehrheit verwandeln lässt.
Gemeint ist eine politische Mehrheit, die sich um ein politisches Projekt herum materialisieren könnte, das alle emanzipatorischen Wünsche in all ihren Variationen im Rahmen eines kollektiven Kampfes gegen das gesamte System der Ausgrenzung berücksichtigt.
Ein emanzipatorisches politisches Projekt, das der Ernsthaftigkeit der Herausforderung durch den Aufstieg der extremen Rechten Rechnung trägt, würde sich entschieden gegen die Politik der liberalen Linken stellen. Einer Linken, die es nicht nur verabsäumt hat, die Probleme anzugehen, sondern aktiv zur Entstehung des Umfelds beigetragen hat, in dem die extreme Rechte so prächtig gedeiht – in einer neoliberalen Zeit, sprich „flachen“ Zeit, in der es keinen erkennbaren Horizont mehr gibt, sondern nur noch aufeinanderfolgende Augenblicke. Einer entpolitisierten Zeit, die sowohl dadurch ermöglicht wurde, dass die liberale Linke das große politische Projekt der sozialen Gerechtigkeit aufgegeben hat, als auch dadurch, dass sie so stark auf Identitätspolitik baut. Diese postideologische Linke, die neoliberale Maßnahmen fördert und gleichzeitig kulturelle Kontroversen als Ersatz für eine echte Debatte über soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit anstößt, ist eine dystopische Linke ohne jede Zukunftsvision, der es an jeglichem Sinn für Fortschritt oder Projekt für eine bessere Zukunft fehlt. Dieses Fehlen echter Bemühungen um eine bessere Zukunft ist ein Zeichen dafür, dass ein beträchtlicher Teil der öffentlichen Meinung mittlerweile von einer nostalgischen Sehnsucht nach einer „besseren Vergangenheit“ beherrscht wird, trotz der potenziellen Katastrophen, die mit dieser verbunden sind.
Schwelle der rechten Ideologie
Betrachtet man den konsequenten Rechtsruck im Europa der letzten 20 Jahre, so könnte man zu der Erkenntnis gelangen, dass dieser nicht allein auf die Wahlerfolge rechtsextremer Parteien zurückzuführen ist. Er beruht auch darauf, dass etablierte Parteien, einschließlich der sozialistischen Linken und der rechten Mitte, zu einer Politik, Sprache und Sichtweise übergegangen sind, die noch vor wenigen Jahrzehnten als rassistisch und fremdenfeindlich galt. Dieser allmähliche Gesinnungswandel etablierter Parteien hin zu einer rechtsextremen Ideologie hat erheblich zum allgemeinen Rechtsruck beigetragen und die Auswirkungen der Wahlerfolge der radikalen Rechten noch übertroffen, und er hat vor allem die rasche Normalisierung derartiger Ideologien befördert.
Was die rechtsextreme Entwicklung in Europa betrifft, so zeigt sich, dass sie in zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten verläuft. Rechte Parteien bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit auf die extreme Rechte zu, während die etablierten Parteien hinterherhinken. Doch auch wenn ihr Tempo gemächlicher erscheinen mag, bewegen sie sich eindeutig in die gleiche Richtung. Dies zeigt sich deutlich an zahlreichen umstrittenen politischen Maßnahmen und Gesetzen, die von den etablierten Parteien verabschiedet, ursprünglich aber von rechtsextremen Gruppierungen vorgeschlagen und befürwortet wurden. Nirgendwo wird dieses ständige Hinterherhinken der etablierten Parteien hinter der rechtsextremen Ideologie deutlicher als in der europaweiten Formulierung und Überarbeitung von Einwanderungsgesetzen in den letzten 20 Jahren, bis hin zum jüngsten Gesetz, das, obwohl umstritten, Anfang dieses Jahres von der Europäischen Union verabschiedet und inhaltlich eindeutig von rechtsextremen Ideologien beeinflusst wurde. Migrationsfeindliche Rhetorik und die Einführung strenger Grenzkontrollen, der starke Rückgriff auf Polizeigewalt gegen politischen Dissens und die Tendenz, abweichende Meinungen zu kriminalisieren – all diese autoritären Maßnahmen sind zu Markenzeichen des Diskurses etablierter Parteien geworden und spiegeln eine Agenda wider, die einst der extremen Rechten vorbehalten war.
Wie es scheint, ist für den Aufstieg der extremen Rechten zur absoluten Herrschaft in Europa kein neuer Hitler oder Mussolini erforderlich, da er in Form einer allmählichen, jedoch beständigen und relativ raschen Übernahme rechtsextremer Ideologie durch etablierte Parteien erfolgt. Ist dies nicht auch in Frankreich der Fall, wo die Hinwendung zur extremen Rechten bis jetzt allein darin bestand, dass deren Politik und Normalisierung des fremdenfeindlichen Diskurses von ihrem vermeintlichen Gegner aus der Mitte und der liberalen Linken übernommen wurde? Dort hat eine pervertierte Laizität der fremdenfeindlichen, rassistischen und islamophoben Politik ein progressives Gesicht gegeben.
Einige migrationsfeindliche politische Programme der Mitte und der Linken waren lange erfolgreich als pseudorationale Berechnungen auf der Basis wirtschaftlicher Stabilität getarnt. Doch dann ereigneten sich an der polnischen Grenze im Abstand von wenigen Monaten völlig gegensätzliche Vorfälle. Beim ersten wurden wir Zeug*innen einer geschlossenen Grenze für Flüchtlinge aus dem Globalen Süden, die in den Wäldern ohne humanitäre Hilfe zurückgelassen wurden. Bei dem Versuch, die Grenze zu überqueren, wurden sie von der Polizei brutal verprügelt und im eiskalten Dezember buchstäblich dem Erfrieren und Sterben überlassen. Der zweite Vorfall ereignete sich zwei Monate später, als eine neue Welle von Flüchtlingen an der polnischen Grenze eintraf. Dieses Mal war die Reaktion jedoch gänzlich anders und nicht so grausam wie zuvor. Was sich dort abspielte, zeugte von einem beispiellosen Humanismus: Flüchtlinge wurden in einer Atmosphäre der Brüderlichkeit, offener Grenzen und der Gastfreundschaft aufgenommen. Dieser eklatante Widerspruch wirft die Frage auf, wie es zu diesem krassen Gegensatz zwischen den beiden Vorfällen kommen konnte. Oder, anders gefragt, wie kam es zu diesem extremen Unterschied in der Reaktion auf das scheinbar gleiche Problem, nämlich dem von „Flüchtlingen“? Aber handelt es sich hier wirklich um ein Flüchtlingsproblem? Geben wir einer Sache den falschen Namen? Falls nicht, warum haben dann Flüchtlinge aus dem Globalen Süden, die versuchten, über die polnische Grenze nach Europa zu gelangen, auf dem ganzen Kontinent eine derartig fremdenfeindliche Empörung ausgelöst? Während zwei Monate später angesichts einer Flut von Millionen von ukrainischen Flüchtlingen in Europa niemand von einer Flüchtlingskrise zu sprechen, geschweige denn ihre Existenz als Problem zu betrachten schien.
Obwohl allgemein behauptet wird, Europa habe den Chauvinismus und Rassismus überwunden, lässt uns die Tatsache, dass Flüchtlinge unterschiedlich behandelt werden und unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, keine andere Wahl, als uns die Identität der Flüchtlinge genauer anzuschauen. Denn nirgendwo sonst als in der Identität der Flüchtlinge lässt sich der Grund für einen so krassen Unterschied in Bezug auf ein und dasselbe Thema finden. Das bedeutet, dass das, was wir unkritisch als „Flüchtlingskrise“ bezeichnen, möglicherweise nicht nur auf die Geflohenen selbst zurückzuführen ist, die in Europa Asyl suchen, sondern vielmehr auf deren jeweilige Identität. Im Gegensatz zu einigen Hunderten von afrikanischen Flüchtlingen, die auf einem Boot auf der italienischen Insel Lampedusa eintrafen und im vergangenen Sommer europaweit einen Aufschrei in Sachen „Flüchtlingskrise“ auslösten, die von einigen aus der Mitte und der extremen Rechten als Invasion dargestellt wurde, scheinen Millionen von Ukrainer*innen als weiße Christ*innen keine Krise zu verursachen. In Anbetracht der je nach Identität der Flüchtlinge sehr unterschiedlichen Reaktionen könnte man argumentieren, dass „Flüchtlingskrise“ nur ein weiterer Euphemismus für etwas Schreckliches ist: die Zunahme der Fremdenfeindlichkeit in Europa.
Die etablierten Parteien hatten es relativ einfach, fremdenfeindliche Positionen aus der rechtsextremen Ideologie in ihre Herangehensweise an die Einwanderungsgesetze zu übernehmen, denn letztendlich richten sich die Einwanderungsgesetze aus europäischer Sicht gegen andere. Aber gerade diese Toleranz und Gleichgültigkeit gegenüber einer Politik, die vermeintlich gegen „andere“ gerichtet ist, erzeugen eine gefährliche Illusion. Es ist diese Illusion, dass es möglich ist, dem anderen gegenüber rechtsextrem und sich selbst gegenüber fortschrittlich zu sein, in den Kolonien barbarisch und in der Metropole zivilisiert, die stets als Schwelle dient. Eine Schwelle, die, wenn sie einmal überschritten ist, die Normalisierung rechtsextremer Politik in allen Bereichen des Lebens und der politischen Freiheit ermöglicht. Gilt das nicht auch für die autoritäre Entwicklung, die Europa in den letzten Jahren erlebt hat?
Nachrichten über Zensur, die Streichung von Fördermitteln, die Aberkennung von Auszeichnungen, kulturelle Hexenjagden, abgesagte Konferenzen, Polizeirazzien bei kulturellen Veranstaltungen und die Kriminalisierung der politischen Opposition sind den europäischen Ländern nicht mehr fremd, sondern in Frankreich, Deutschland und vielen anderen europäischen Staaten alltäglich geworden. Und all dies, obwohl die extreme Rechte in diesen Staaten noch nicht an der Macht ist und ich noch kein einziges Wort über die israelischen Gräueltaten im Gazastreifen bzw. die Art und Weise verloren habe, in der Zivilpersonen, insbesondere Palästinenser*innen, von europäischen Politiker*innen der Linken und der Mitte gleichermaßen als weniger wert und „unbetrauerbar“ behandelt werden. Zu ihnen gehört auch der ehemalige französische Präsident François Hollande, der bei der Verteidigung der Gewalt in Gaza so weit ging, dass er zwei unterschiedliche Arten von zivilen Todesfällen herbeiphilosophierte: Eine davon ist akzeptabel, nämlich der Tod von über 30.000 Palästinenser*innen, die Hälfte von ihnen Kinder; sie tut er als Kollateralschaden eines gerechten Krieges ab. Die andere Art, die der ehemalige Präsident als Einzige für inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen hält, ist der Tod israelischer Zivilist*innen. In ähnlicher Weise wurde Claudia Roth, die Beauftragte der deutschen Bundesregierung für Kultur und Medien, dabei ertappt, wie sie bei den Berliner Filmfestspielen sowohl dem palästinensischen Regisseur Basel Arida als auch seinem israelischen Kollegen Yuval Abraham für ihren gemeinsam gedrehten Anti-Apartheid-Film applaudierte, der einen der Hauptpreise des Festivals gewonnen hat. Als die Kulturbeauftragte dafür kritisiert wurde, dass sie dem palästinensischen Preisträger applaudiert hatte, betonte sie, dass sie in diesem Moment nur für den Israeli, nicht aber für seinen palästinensischen Partner geklatscht habe. Schockierend? Nein? Ziemlich surreal.
Wie kann ein sozialistischer Präsident so tief sinken, so weit nach rechts abrutschen, dass er sich auf die Perspektive einer kolonialen weißen Vormachtstellung zurückzieht, um die Tötung unschuldiger ziviler Palästinenser*innen durch israelische Flächenbombardierungen in Gaza als notwendiges Übel zu legitimieren? Man würde sicherlich gerne wissen, wie der deutschen Kultur- und Medienbeauftragten ein derartiger Apartheidsapplaus gelungen ist, der den israelischen Yuval und nicht den palästinensischen Basel erreichte, obwohl in dem Moment, als sie klatschte, beide auf der Bühne standen. Noch einmal: All dies passiert, ohne dass die Rechtsextremen schon an der Macht wären. Und es sind nur einige Beispiele von Politiker*innen, die vermeintlich auf der progressiven linken Seite der „Kulturkämpfe“ stehen.
Wenn es jetzt also etwas anzugehen gäbe, dann keine „Kulturkämpfe“, sondern definitiv einen kulturellen und politischen Widerstand gegen die rechtsextreme Ideologie und ihre rasche Normalisierung und Anpassung bei den konkurrierenden etablierten Parteien der linken und der rechten Seite in Europa. Ein kultureller Widerstand gegen die zerstörerische Ideologie des „Othering“, der Ausgrenzung, der Problematisierung der bloßen Koexistenz mit „Anderen“, der Verwandlung ihrer bloßen Existenz in einen Treibstoff, um den Hass in der Gesellschaft zu schüren. Ein kultureller und politischer Widerstand gegen die ausgrenzende rassistische Ideologie des Nationalstaats, die sich vor unseren Augen ausbreitet und sich neu manifestiert, sobald sie ein neues Objekt des Hasses, der Diskriminierung, der Entmenschlichung des neuen Anderen ins Visier nimmt, um dessen Anwesenheit herum sie eine existenzielle Bedrohung erschafft, die der abwegigen Idee vom „großen Austausch“ ähnelt, in der viel von der alten antisemitischen Propaganda um eine von jüdischen Verschwörer*innen kontrollierte Welt anklingt. Eine gefährliche Ideologie, die, sollte sie in unserer globalisierten, multiethnischen Gesellschaft die Oberhand gewinnen, uns an den Rand eines globalen Bürgerkriegs führen wird. Einem solchen Katastrophenszenario vorzubeugen und Widerstand zu leisten, ist der einzige politisch-kulturelle Kampf, den es sich heute in Europa zu führen lohnt.
Übersetzt von Anja Schulte