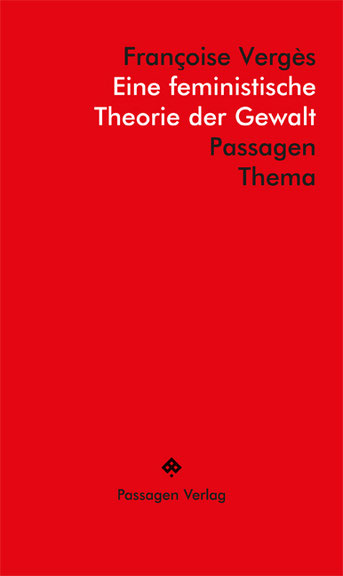Es ist das Buch der Stunde, denkt man, wenn man Françoise Vergès’ Eine feministische Theorie der Gewalt zur Hand nimmt. Die Autorin, streitbare Vertreterin eines dekolonialen Feminismus in Frankreich1, schafft es in ihrer Analyse jedoch rasch, einen anderen Blick zu vermitteln: Femizide, Vergewaltigungen, sexuelle Gewalt sind Teil unserer Gesellschaften, auch wenn aktuell die kriegerische Gewalt verstärkt ins (europäische) Bewusstsein rückt.
Den Eindruck eines sich verschlimmernden Phänomens unterstützen die Medien, die inzwischen über jeden einzelnen Femizid berichten. Was aber lange als wichtige feministische Forderung galt, das Öffentlichmachen dieser Verbrechen, schiebt die Verantwortung – vom Boulevard angetrieben – immer mehr von der Mitte der Gesellschaft an nicht-weiße Männer ab.
Françoise Vergès bezieht auch aus diesem Grund Männer als Betroffene von rassifizierter und klassistischer Gewalt und Prekarisierung mit ein: „Meine Analyse […] versucht, zu einem Denken über Gewalt anzuregen, das sie als strukturierendes Element des Patriarchats und des Kapitalismus versteht, statt nur als männliches Spezifikum.“ Auch wenn sich zunächst alles dagegen sträubt, die Einbeziehung von Männern (von denen manche, wie sie selbst schreibt, die Bezeichnung „Henker“ durchaus verdienen) als Betroffene in einer intersektionalen, feministischen Analyse zu akzeptieren, gelingt es Vergès, mit Zahlen und Fakten, zugleich mit Bezug auf wichtige Vordenker*innen und den Stimmen rassifizierter Frauen bzw. diskursanalytischen Methoden inklusive einiger haarsträubender Aussagen von Politiker*innen zu überzeugen: So sah sich etwa eine französische Exfrauenministerin im Zusammenhang mit der Vergewaltigung einer Schwarzen Migrantin durch Dominique Strauss-Kahn, zu der Zeit Direktor des IWF, dazu veranlasst, die Sprache umgehend auf die „jungen Schurken aus den Problembezirken“ zu lenken.
„Ein dekolonialer Feminismus“, so Vergès, „muss diese jungen Männer aus den Arbeiter*innenvierteln miteinbeziehen und kann die „Gewalt gegen Frauen“ oder „Minderheiten“ nicht von einem allgemeinen Zustand der Gewalt trennen: von den Geflüchteten in den Lagern, den klimabedingt ins Exil Vertriebenen und vielen mehr.
Vergès, Tochter politischer Aktivist*innen und in den Befreiungsbewegungen und -kämpfen der 1960er- und 1970er-Jahre sozialisiert, fokussiert auf Gewaltformen, die durch Rassismus, Prekarisierung und Armut bedingt sind. Dabei identifiziert sie den Neoliberalismus und sein ausbeuterisches Wirtschaftsmodell als Treiber von Gewalt – gegen „Minderheiten, Transpersonen, queere Menschen, Sexarbeiter*innen, Migrant*innen und Muslim*innen“.
Sie alle gälte es, gleichzeitig gegen den „Femo-Imperialismus“ und die „sozialistischen Femokratinnen“ mit ihrer „Hurenphobie und Sicherheitsideologie“ zu verteidigen: Während Erstere die Frauen des globalen Südens vor Dingen zu retten versuchten, die – wie die Genitalverstümmelung – heute kein Problem mehr seien, wollen die „Femokratinnen“ mit härteren Strafen unter anderem die Prostitution abschaffen, die für viele Migrantinnen die Existenzgrundlage ist. Vergès geht es um deren „erschöpfte“ Körper und die strukturelle, systemische Gewalt, die nicht-weiße Personen in einen frühzeitigen Tod treiben.
Den Weg in eine „post-gewaltvolle Gesellschaft“ sucht sie deswegen auch nicht bei den staatlich-patriarchalen Autoritäten, wie es der von ihr vehement abgelehnte „strafende Feminismus“ tut. Schließlich würden höhere Strafen und Sicherheitsmaßnahmen nicht nur das Leben von Migrant*innen verschlimmern; vielmehr würden sie Angst als „feminine Eigenschaft“ festschreiben, wobei, wie sie schreibt, noch kein Gefängnisaufenthalt jemanden vom weiteren Töten abgehalten hätte.
Was also tun, wenn es keine Option ist, den Schutz von Frauen in die Hände des Staates zu legen oder selbst zur Waffe zu greifen? Bei allem Verständnis für die Wut von Frauen argumentiert Vergès – einmal mehr überraschend – auch gegen Selbstverteidigung. Sie nimmt dabei Bezug auf den Roman Die Gabe von Naomi Alderman, in der Frauen die „Gabe“ entdecken, übergriffige Männer mit elektrischen Schlägen zur Strecke zu bringen. Am Ende etablieren diese Frauen eine Schreckensherrschaft und kehren die Verhältnisse bloß um.
Auf weitere Gewalt von oben will Vergès jedoch gleichfalls nicht hinaus. Sie fordert mehr Einfallsreichtum und findet ihn in den „Parabeln“ von Octavia E. Butler und einer ihrer Protagonistinnen, die an „Hyperempathie“ leidet, und den Widerstand in eine Welt führt, in der das Gemeinwohl Priorität hat.
„Wir müssen es wagen, von einem friedlichen Leben zu träumen“, schreibt Vergès darauf aufbauend, und man weiß, dass sie damit nicht Befriedung oder Beschwichtigung meint. Ihr Lieblingsangriffsziel scheinen vielmehr gerade die Repräsentantinnen fehlgeleiteter (feministischer) Wege zu sein, die ihre „weiße Welt“ von rassifizierten Frauen putzen lassen. Als Betroffene von Gewalt gegen Frauen tauchen sie (oder Initiativen wie #MeToo) in ihrer Analyse nicht auf, dabei lernt man eigentlich gerade bei ihr, sich beim Kampf gegen Gewalt nicht individualisieren oder auseinanderdividieren zu lassen.
Dass Vergés mit ihrer dezidiert dekolonialen Perspektive, Ideen aus Science-Fiction-Romanen und klugen, teils angriffigen Thesen das Bewusstsein für die schier unbewältigbar scheinende Problematik schärft, ist ihr hoch anzurechnen. Ihre Conclusio ist dennoch nicht ganz so umwälzerisch, wie es die von ihr eingeforderte „revolutionäre Liebe“ erwarten lässt. Denn schließlich setzt auch sie – wie viele andere (feministische) Initiativen vor ihr – auf vermeintlich simple Basics: „organisierte Zusammenarbeit“ und „Solidarität mit denen, die nichts zu verlieren haben“.
1 Vgl. „Es geht um Befreiung, nicht um Freiheit“, Françoise Vergès im Gespräch mit J. Emil Sennewald, in: springerin 2/2020, S. 31.