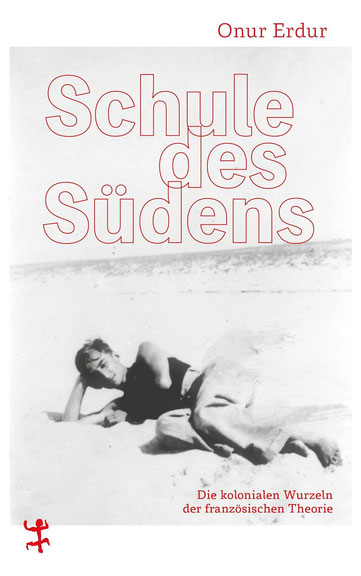Heft 3/2024 - Lektüre
Onur Erdur:
Schule des Südens – Die kolonialen Wurzeln der französischen Theorie
Als eine der besonderen – und besonders verwerflichen – Kuriositäten im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine gilt in unseren Augen wohl, dass dieser Krieg im Land des Aggressors nicht bei seinem Namen genannt werden darf, sondern dort der Euphemismus „militärische Spezialoperation“ in Kraft gesetzt wurde. Nun würde man vielleicht leichtfertig annehmen, ein solch zynisches Sprechverbot wäre nur in nicht-westlichen Autokratien, das heißt in absoluten Schurkenstaaten vollstreckbar – doch weit gefehlt. Denn dergleichen Mystifizierungen waren, und das vor gar nicht so langer Zeit, sogar im Herzen Europas nicht inopportun, als es nämlich im vom Algerienkrieg (1954–62) gebeutelten Frankreich darum ging, die Gewaltexzesse der eigenen Armee zu bemänteln, und hierbei in verbrämender Weise lediglich von „Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung“ die Rede war. Diese wenig rühmliche propagandistische Volte fiel später allerdings der Vergessenheit anheim, so wie Frankreich aber überhaupt lange – mindestens bis in die 1990er-Jahre, als der Bürgerkrieg in Algerien (1991–2001) wieder alte Wunden aufriss – damit haderte, sich seiner kolonialen Vergangenheit zu stellen; und das tut es eigentlich selbst heute noch eher nur zögerlich. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass im Zuge dieser kollektiven Amnesie auch die kolonialen Wurzeln der french theory, also der die geistige Szene seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beherrschenden philosophischen Strömungen wie Strukturalismus, Poststrukturalismus, Dekonstruktion oder Postmoderne – deren Dominanz heute durchaus an ein Ende gelangt zu sein scheint –, völlig aus dem Blick gerieten. Denn es hätte ganz gewiss nur wenig Anklang gefunden, hätte man den Glanz der französischen Intellektuellen mit dem Dunkel der Kolonialzeit in Verbindung gebracht.
Doch nun ist der in Berlin lehrende Historiker und Kulturwissenschaftler Onur Erdur angetreten, hier – wie er indes gänzlich frei von jeder Unbescheidenheit bekundet – erstmalig Aufklärung zu schaffen und zu beleuchten, inwieweit die koloniale Kehrseite der Trente Glorieuses, also der französischen Wirtschaftswunderjahre von 1945 bis 1975, Auswirkungen auf die Theorieproduktion und ihre prägenden Figuren hatte. Methodisch lässt er sich dabei von der Grundannahme leiten, dass „die Entstehung von Theorien […] untrennbar verbunden ist mit der gelebten Erfahrung ihrer Urheberinnen und Urheber“: ein Ansatz, mit dem er sich ironischerweise aber in einen diametralen Gegensatz zu einigen seiner Protagonist*innen bringt, hatten doch zum Beispiel ein Roland Barthes oder Michel Foucault den für seine Texte allein verantwortlichen Autor entweder gleich entsorgt oder wenigstens zu einer Autor-Funktion bzw. einem Autor-Diskurs entpersönlicht. Ordur ist sich dieser Fallstricke freilich bewusst und meidet darum jeden plumpen Biografismus, mithin jede eindeutige Ursprungslogik, die das Denken an spezifische soziale oder politische Umstände rückbinden würde. Und diese Brüchigkeit – oder wenn man so will: Kontingenz – zeigt sich allein schon daran, dass viele der kolonialen Erfahrungen erst mit erheblicher Verzögerung Eingang in die jeweiligen Theorien gefunden haben.
Vor dieser kolonialen Realität ließen sich in den 1950er- und 1960er-Jahren aber auch schwerlich die Augen verschließen; und schon gar nicht durfte man das in Frankreich als Intellektueller tun, als welcher man seit den Tagen Zolas – und Sartre rief diese Verpflichtung mit seinem 1947 entstandenen Schlüsseltext Was ist Literatur? eindringlich in Erinnerung – in unverbrüchlicher Weise politisches Engagement zu zeigen hatte, wollte man dem hohen Ethos des Standes genügen. Und so kommt es auch, dass sich die moralische Frage des Kolonialismus beinahe wie ein Grundmotiv durch die Einlassungen der französischen Meisterdenker*innen zieht, und das wird mitunter sogar für deren bekannteste Theorien und Werke schlagend: So frappiert, und das scheint ein überaus evidentes Beispiel, beim Blick in die vollständige Ausgabe von Barthes’ Mythen des Alltags (die mittlerweile zum Glück auch auf Deutsch vorliegt) tatsächlich der hohe Anteil an Artikeln mit dezidiert antikolonialistischem Impetus – Texten, die die repressive Ideologie der kolonialen Diskurse sowie die scheinheilige Rhetorik der französischen Politik kompromisslos entlarven; Bourdieus berühmte Habitus-Theorie, die zumeist – in polemischer Absicht – am französischen Bürgertum exemplifiziert wird, wurde von ihm zuerst an der kabylischen Bauernschaft erprobt, die mit den kapitalistischen Herausforderungen der Moderne überhaupt nicht zurechtkam; und Lyotards nicht weniger berühmter Befund vom Ende der großen Erzählungen lässt sich Erdur zufolge mit seinen Erfahrungen als junger Schullehrer in Algerien kurzschließen, der vor den bildungspolitischen Trümmern der französischen Zivilisierungsmission stand, die dem Land traditionell als Rechtfertigung für seinen kolonialen Eifer diente.
All dies wird im Rahmen von acht Einzelessays ausbuchstabiert, die sich jeweils einer Person, einem Ort und einem „theoretischen Kristallisationsmoment“ widmen, ohne dass die Porträts – das Beispiel Lyotard macht hier Schule – von einer übergeordneten Metaerzählung verklammert würden; ein solches Fazit findet sich dann eher im Schlusskapitel, in dem Erdur zu einer Art Ehrenrettung der french theory ansetzt. Eine Sache gibt es aber doch, die fast alle Protagonist*innen letztlich teilen: So gut wie jede*r von ihnen weiß nämlich von einer Art Schlüsselerlebnis zu berichten, das zum je eigenen intellektuellen Erwachen geführt hat – einem Erwachen unter der Sonne des Südens.