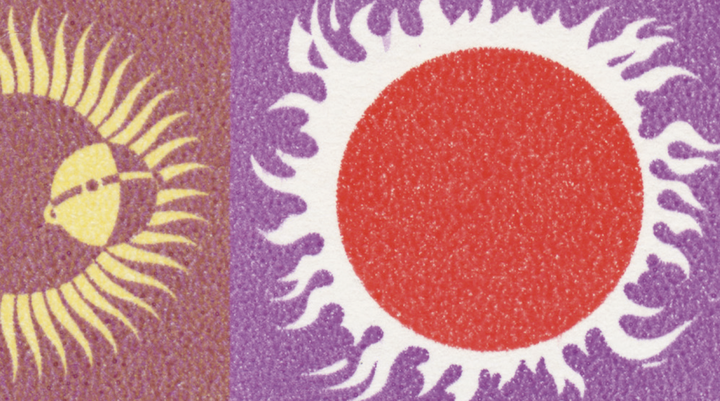Wien. In Kooperation mit den Wiener Festwochen/Freie Republik hat die Kunsthalle Wien mit der Ausstellung Genossin Sonne Zusammenhänge zwischen revolutionären politischen Ereignissen und den zyklischen Abläufen auf der Sonne thematisiert. Zumindest gilt dies für einige der zentralen Arbeiten innerhalb der von Video- und Filmarbeiten dominierten Präsentation, die von Inke Arns und Andrea Popelka kuratiert wurde. Die dem Ausstellungskonzept zugrunde liegende Verknüpfung von Naturereignis und Geschichtsverlauf gründet in einer These des russischen Heliobiologen Alexander L. Chizhevsky (1897–1964), die besagt, dass die von der Anzahl der Sonnenflecken bestimmte Sonnenaktivität Einfluss auf die Agilität bzw. Passivität irdischer Akteur*innen hat.
Der mit der Ausstellung vertretene Anspruch, „politisch engagierte künstlerische Praktiken“ die sich „mit sozialen Fragen und global polarisierenden Debatten“ auseinandersetzen, zu fördern, setzt sich damit der problematischen Prämisse aus, Geschichte zu naturalisieren und damit als gesellschaftliches Phänomen zu neutralisieren. Darin verbirgt sich eine Form des philosophischen Irrationalismus, die sich als posthumanistische Reaktion auf den Rationalismus kapitalistischer Ausbeutungs- und Verwertungszusammenhänge mit deren katastrophalen Folgen für Natur und Gesellschaft erweist. Die jüngsten Sonnenstürme, die terrestrischen Energiesysteme lahmlegen können, belegen unzweifelhaft den Einfluss des Muttergestirns auf die Erde und niemand wird bestreiten, dass die Erde als Teil des Kosmos auch dessen Gesetzen unterliegt. Und dennoch: Die Frage politischer und persönlicher Verantwortung im gesellschaftlichen Handeln bleibt trotz unhintergehbarer naturbedingter Vorgaben aufrecht.
Vor allem das großformatige Diagramm am Eingang zur Ausstellung, das einschneidende Wirtschaftskrisen und politische Revolutionen seit 1785 in ein Kausalverhältnis zu den Phasen des Sonnenzyklus setzt, muss ohne kritische Kontextualisierung wie ein Plädoyer für die gesamte Schau erscheinen. Sein Urheber, der Ökonom Mikhail Gorbanev, ist auch Autor des Essays im ausstellungsbegleitenden Beiheft. Dort beschreibt er die coronabedingten Lockdowns als die „passivste Option“ der Menschheit, die – sonnenbedingt – aus der Gesundheitskrise die tiefste Wirtschaftskrise der Neuzeit machte. Auch glorifiziert er Alexander Chizhevsky, der aufbauend auf den Mythen des russischen Kosmismus, diesen mit seinen abstrusen Ewigkeitsfantasien in die Zeit nach der Moderne hinüberrettete. Dieser Thematik nimmt sich Anton Vidokle in seiner Filmtrilogie Immortality for All an, von der in der Ausstellung der Abschnitt The Communist Revolution was Caused by the Sun (2015) zu sehen ist. Seine filmische Collage unterlegt das Leben kasachischer Bauern mit Zitaten aus Chizhevskys Schriften und einer seiner ufonautischen Konstruktionen. So entsteht ein bild- und textgewaltiger Mix aus Geschichte, Religion, Poesie und Technologie als Ausbruchsversuch aus irdischer Begrenztheit.
Auf konkrete politische Ereignisse beziehen sich die Arbeiten der Otolith Group, der Atlas Group sowie des Colectivo Los Ingrávidos. Letztere spannen im Video Sun Quartet (2017–20), einen Bogen vom Widerstand der indigenen aztekischen Bevölkerung gegen die spanischen Eroberer bis hin zur Ermordung von 43 Studierenden, die 2014 im Auftrag der Regierung von der Polizei entführt wurden – ein aus sich überlagernden Bild- und Tonspuren buchstäblich flammendes filmisches Pamphlet gegen das Verschwinden und Verdrängen. Mit In the Year of the Quiet Sun (2013) bezieht die Otolith Group das alle elf Jahre auftretende Phänomen einer Temperaturabsenkung auf der Sonnenoberfläche auf die zeitgleichen panafrikanischen Aktivitäten, deren Optimismus sich nicht zuletzt in der Herausgabe von Sondermarken mit Sonnenmotiven zeigte. Der Film handelt aber auch vom Scheitern der Utopien am kolonialen Erbe und deren korrupten Strukturen. Das Versagen, aber auch die Perfidie staatlicher Spionageaktivitäten spiegelt sich in jenem Video der Atlas Group, in dem ein Spionageagent mehr an den Aufnahmen von Sonnenuntergängen interessiert ist als an potenziell dubiosen Passanten an einer Strandpromenade in Beirut. Mit Huda Takritis Posterinstallation in der Brunnenpassage, die Verbindungen von Unterdrückung, politischem Widerstand und Literatur aufzeigt, bespielt Genossin Sonne auch den Außenraum.
Dystopische Szenarien entwerfen die Videos von Gwenola Wagon und Maha Maamoun. Wagons Chronique du Soleil Noir denkt den Klimawandel zu Ende und handelt von einer Zukunft, in der sich die Menschheit nur mehr durch die Abschirmung von der Sonne vor deren Hitze retten kann, um zugleich durch archivalische Bilder der Sonne deren Verlust zu kompensieren. Wie Wagon bezieht sich auch Maamoun auf Chris Markers La Jetée, um eine in Zukunft stattfindende Revolution zu imaginieren, die zugleich an den Arabischen Frühling erinnert.
Gegenüber der Lichterflut der Videos versinkt der übrige Ausstellungsraum im Dunkeln, worunter die Sichtbarkeit einiger Arbeiten leidet, wie etwa Kobby Adis fluoreszierende Kristalle oder Kerstin Brätschs Sonnenschildobjekt. Auch Hajra Wahededs von der Sonne gebleichte Papierarbeit kann sich visuell kaum gegenüber der alles überstrahlenden Nahaufnahme der brodelnden Sonne von Katharina Sieverding behaupten. Marina Pinskys subtile Arbeit verweist auf den Konnex von Zeit-/Raumvorstellungen und sich wandelnden technologischen Bedingungen, Suzanne Treisters diagrammatische Comics laden das Ausstellungsthema ebenso mit ironischer Distanz auf wie die Gemälde Wolfgang Mattheuers. Eine raumübergreifende Funktion erfüllen die Space-Junk-Objekte von Sonia Leimer, die daran erinnern, wie sehr die Instrumentarien der Digitalisierung wie die Satelliten der Menschheit auch auf den Kopf fallen können – ein aufklärerisches Werk ganz ohne Kommunismus und Sonnenkult.