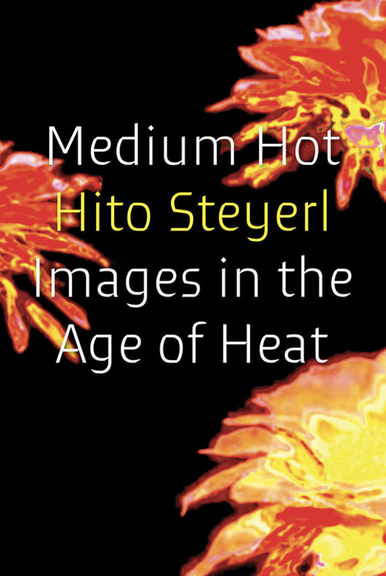In ihrem neuen Essayband Medium Hot: Images in the Age of Heat spannt die renommierte deutsche Künstlerin und Theoretikerin Hito Steyerl ein großes, diskursives Netz: Künstliche Intelligenz, damit generierte Bilder, Machtverhältnisse, Waffenentwicklung, Arbeit, Klasse, Ökologie, Klimakrise – kurz: Es geht um die ideologische Temperatur der Gegenwart. Darüber hinaus verweist der Titel auf Medientheorie und künstlerisches Schaffen: Marshall McLuhans etwas in die Jahre gekommene Differenzierung von heißen und kalten Medien sowie Haskell Wexlers Film Medium Cool, der unter anderem während der Proteste bei der Democratic National Convention 1968 in Chicago gedreht wurde und sich zentral mit dem Akt des image-making, also der Bildproduktion, beschäftigt.
Dieser steht auch im Fokus von Medium Hot, jedoch geht es Steyerl nicht um den menschlichen Akt mittels eines Mediums, sondern um GenAI – generative artificial intelligence, jene Künstliche Intelligenz, die im Unterschied zur ‚klassischen‘ analytischen KI verwendet wird, um neue Inhalte zu generieren. Es sind die politischen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen von GenAI, die Steyerl in den elf Essays (zwischen 2021 und 2024 entstanden) in verschiedenen Formen aufzeigt: vom Aufsatz über einen Vortrag bis hin zum experimentell-ironischen Selbsttest.
Steyerl, deren Schriften und künstlerische Arbeiten den Diskurs um Kunst und ihre digitale Reproduzierbarkeit in den letzten Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt haben, ist äußerst hellsichtig und eindrücklich in ihren Beschreibungen der Gefahren und diskriminierenden Mechanismen von KI, aber auch anderen digitalen Technologien. Sie skizziert etwa, wie das Tagging von Straßenfotos für digitale Routenplaner vor allem Frauen in Geflüchtetencamps via Micro-Gig-Economy ausbeutet oder wie rechtliche Leerstellen das Mining von NFTs im Kosovo auf Kosten der Gemeinschaft ermöglichte. Wer sich dessen noch nicht gewahr war, dem bleibt nach der Lektüre kein Zweifel, dass die großen Gewinne der Tech-Konzerne und die hehren Verheißungen von KI stets zulasten des Gemeinwohls und der Demokratie gehen.
In den teils recht kurzen Essays streift Steyerl viele verschiedene Themen, wodurch es zu Wiederholungen und Argumentationsschleifen kommt, die letztlich alle zu den gleichen Schlussfolgerungen führen. Als Leserin ohne Expertise im Gebiet der Künstlichen Intelligenz beschleichen eine immer wieder Zweifel, etwa was die Differenz von analytischer und generativer KI angeht, wenn Steyerl vor dem Einsatz von racialised surveillance warnt und kurz darauf über generierte Versionen von Manets Frühstück im Grünen schreibt, mit geradezu verstümmelten Figuren. Inwiefern sind beide Technologien gleich gefährlich, von ihren Produktionsbedingungen abgesehen? Eine systematische Unterscheidung zwischen analytischer KI – etwa im Kontext von Polizeiarbeit oder Überwachung – und generativer KI, wie sie in Bild- oder Textproduktion zur Anwendung kommt, wäre hier durchaus hilfreich, um den Argumentationslinien besser folgen zu können. Doch vermengt Steyerl immer wieder verschiedene Technologien, die alle dieselben Konsequenzen nach sich ziehen, wodurch es letztlich schwerfällt, sie auseinanderzuhalten.
Ein weiterer Zweifel stellt sich vor dem Hintergrund der Kunstwelt ein: Wer hält KI überhaupt noch für die ultimative Heilsbringerin in der künstlerischen Bildproduktion, nachdem sich herausgestellt hat, dass selbst die Reproduktion einfachster Bildlogiken das Vermögen der Technologie übersteigt? In der Tat geht es in Medium Hot erstaunlich wenig um Kunst. Steyerl operiert nicht in der Kunsttheorie, sondern im Bereich der Bildpolitiken und Kulturkritik im Allgemeinen. Kunst bezeichnet sie als Vorwand, um der Top-down-Implementierung von GenAI Bedeutung zu verleihen. Unter anderen Umständen könne sie ein interessantes Tool sein, etwa durch die Entwicklung weniger von fossilen Brennstoffen abhängiger Infrastrukturen und Open-Source-Modellen, schreibt sie. Und doch hätte man sich konkretere Einblicke in das künstlerische image-making gewünscht. Es lässt sich nur vermuten, dass Steyerls eigene Praxis ein fruchtbares Untersuchungsfeld gewesen wäre, hat sie doch selbst zur Genüge mit KI-basierten Systemen experimentiert.
Steyerl scheint durchwegs viel vorauszusetzen und wenig an basalem Wissen oder Begriffen erklären zu wollen, stellt gleichzeitig aber auch immer wieder starke Thesen auf, ohne sie allzu ausführlich zu untermauern. Kurz rekurriert sie auf das zugegebenermaßen trostlose und äußerst kurzlebige NFT-Kapitel der Kunstgeschichte, wischt aber über deren Funktionsweise eher unwirsch hinweg: „Because this concept is confusing on purpose, it does not make a lot of sense to explain it.“ Sie sieht Krypto-Kunst als Strategie des ‚onboarding‘, mit der Menschen an Tools wie elektronische Wallets oder Konten gewöhnt werden sollen und so letztlich Teil eines extraktiven Systems werden.
Dieser Modus wirft die Frage auf, welches Publikum genug Vorwissen mitbringt für einen kurzen Band, der im Tonfall des Art English über komplexe Technologien und ihre Auswirkungen doziert, ohne dabei tiefergehende Erkenntnisse oder Recherchen zu teilen, die nicht bereits aus der Tagespresse bekannt sind. Steyerls Sätze klingen oftmals gut, ihre genaue Bedeutung bleibt jedoch bisweilen unscharf; nicht zuletzt strapaziert sie das Sprachbild der Temperatur mitunter bis ins Kalauerhafte. Von genaueren Analysen und mehr Recherche hätte der Band durchaus profitieren können, so hingegen bleibt er, was der Titel prophezeit: etwas lauwarm.
Das Buch erscheint am 30. November 2025, übersetzt von Sabine Schulz, bei Diaphanes Zürich auf Deutsch.