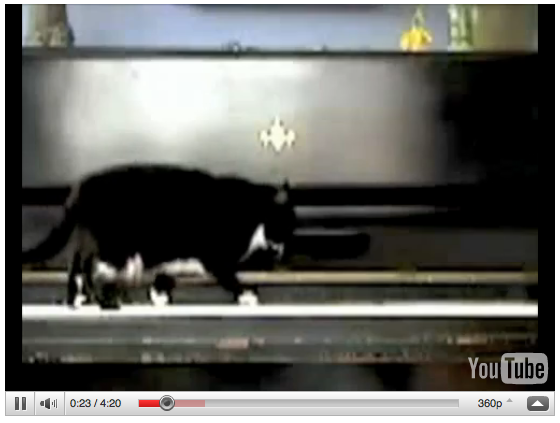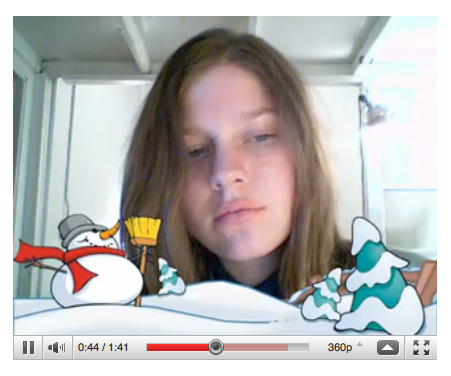Popkultur scheint als Maßstab aus der Kunst zu verschwinden. In Ausstellungen scheint sie als Referenzsystem kaum noch vorzukommen. Besonders auffällig war dieser Umstand in diesem Jahr bei der 6. Berlin Biennale. Stattdessen werden mit Sorgfalt dem Kunstsystem immanente Zitate verwendet, wird Moderne als ästhetischer und ideeller Referenzpool bestimmt oder mit dokumentarischen Mitteln gearbeitet. Woran es nun liegen mag, dass die Popkultur als Referenz nicht mehr attraktiv ist? Ausschließlich einer kuratorischen Auswahl kann diese Beobachtung nicht geschuldet sein.
Der im Sommer 2010 in dieser Zeitschrift veröffentlichte Essay von Lawrence Grossberg enthielt einige Hinweise, die das Phänomen indirekt erklären könnten.1 Grossberg schreibt, Popkultur sei (in den USA) nicht mehr so wichtig, weil sich der »affektive Raum der Jugend« verändert habe und »Technologie und Ökonomie als Ort populärer Unsicherheit und Investition« wichtiger geworden seien. Doch diesen veränderten affektiven Raum beschreibt er nicht näher.
Vielleicht ist YouTube (bis jetzt) so etwas wie das Schlusslicht der großen Formation Popkultur, ein großes Viewer’s Digest. Alles wird noch mal wiederholt oder imitiert, was die »kleinen« Produzenten von den Majors und vom TV gelernt haben. Bestätigt wird diese Annahme durch die vielen Antwortvideos, Inhalte scheinen sich von alleine nachzubilden, das Gesehene lässt sich revisualisieren. So ermöglicht YouTube, die (positiven) Folgen von Popkultur in die Öffentlichkeit zu bringen, etwa die emanzipatorische Funktion von Fankultur. Wie eine späte Bestätigung des widerständigen Potenzials – zentrale Botschaft der Birmingham School – kann die umfangreiche Videoclip-Produktion gelesen werden.
Zum Inventar der Popkultur gehören konventionell Medien und Konsumgüter. Was bedeutet es, wenn laut Grossberg die Technologie wichtiger wird? Ist der »way of life«, wie ihn der Kulturtheoretiker Raymond Williams schon 1958 in der Kultur sah, heute über Technik definiert, etwa Smartphones, Digitalkameras, Netbooks und das Internet? Hat die Informationsgesellschaft hauptsächlich an ihren Displays und der Omniverfügbarkeit von Information gearbeitet? Angenommen, das ist der Fall, dann stellt sich die Frage nach dem Inhalt.
Das Suggerieren eines intimen Zuschauerproduzenten ist der Inhalt des Videos »vvebcam« (2007) der Künstlerin Petra Cortright, die verschiedene Clip-Art-Bildchen wie Pizzastücke, Glitzer, Gitarren, Katzen am Monitor ausprobiert und sich dabei aufnimmt.2 Mit einem lakonischen Langeweileblick lässt Cortright die lustig blinkenden Motive, Boten der Aufmerksamkeitsökonomie, in ihrem Clip-Universum absichtlich in die semantische Leere gleiten. Intimität wird in Form der vor den ZuschauerInnen ausgebreiteten Beschäftigung zum einzigen Inhalt des Videos. Die Betonung der Leere ist das, was die künstlerischen Bearbeitungen tendenziell von der Masse der YouTube-Clips unterscheidet.
Die neue Referenzkultur
Was die Videomasse wiederum von der vertrauten Popkultur unterscheidet: Sie macht ihre Referenzen produktiv. Der Journalist Dirk von Gehlen beobachtet, dass die »Referenzkultur« aufgrund der Demokratisierung der Publikationsmittel und Veröffentlichungsmöglichkeiten zunimmt. Daher ist für KünstlerInnen kaum noch Abgrenzung möglich. Kunst muss sich also grundsätzlich infrage stellen, was ihren Umgang mit den digitalen »Images« angeht. Als Beispiel für die populäre Praxis nennt Gehlen einen Nike-Spot, der entstand, nachdem der Basketballspieler Lebron James von Cleveland nach Miami wechselte. Seine Fans nahmen ihm die Entscheidung übel, und Nike finanzierte die Entschuldigung in Form einer Videobotschaft, »Rise«. »What should I do?«, heuchelt der Sportler im Originalclip. Die Fans reagieren mit zahlreichen Antwortvideos. Seitdem die »Inhalte vom Träger gelöst« sind, so Gehlen, »ist das Umgestalten eine Allerweltstechnik. Fans können sich die Mittel der Kulturindustrie, der Image-Arbeit, aneignen«3. Und das mit einer Technik, die aus der Kunst kommt.
Ein Künstler wie Cory Arcangel schreckt wegen der Ununterscheidbarkeit von Kunst und Hobbyclip nicht vor dem Footage zurück. »Though certainly vernacular culture has populated places once strictly the domain of artists, it is this movement itself which interests me.« In seinen Videos »Drei Klavierstücke op 11« geht es genau um diesen »shift itself«.4 Mithilfe eines selbst geschriebenen Computerprogramms hat er Tausende von YouTube-Videos, in denen Hauskatzen über eine Klaviertastatur laufen und zufällig auf Tasten treten, so ausgewertet und geordnet, dass die jeweiligen Töne ein Klavierstück von Arnold Schönberg ergeben. Mit Schönberg ironisiert Arcangel die liebevollen Clips der KatzenbesitzerInnen und greift im selben Zug deren Begeisterung auf. Zusammen mit seinen Videos listet er eine Reihe von anderen Clips, »that are as good and many times similar to my favorite video artworks«. Damit definiert Arcangel den produktiven Kontext seiner Arbeit und hebt sich doch durch seinen konzeptuellen, zeitaufwendigen Ansatz ab.
So wie der Künstler Ryan Trecartin in seinem 45 Minuten langen Video »P.opular S.ky (section ish)« (2010) das YouTube-Material mixt,5 entsteht ein fast soghafter Bildteppich, in dem immer wieder illustre »5 minutes of fame«-Videostars nachgemacht werden, zum Beispiel Chris Crocker oder Da Young and Da Mess. Dieser Bilderfluss ist reich an visuellen und technologischen Referenzen, die das Netz hervorgebracht hat. Liegt der Unterschied zwischen der Popkultur des 20. Jahrhunderts und der Referenzkultur des 21. Jahrhunderts vielleicht darin, dass die neue Referenzkultur »arm« bzw. extrem reduziert ist, was die Bildqualität, die Produktionsgelder und die Datenmenge angeht? Mit Affirmation als widerständiger Strategie entsteht eine Referenzkultur, die auf dem besten Wege ist, die zukünftige Popkultur zu werden.
Andy Warhol war der Erste
Des Öfteren wird im Zusammenhang von Kunstkritik die Verbindung von historischer Videokunst und YouTube bemüht. Vor allem von jungen VideokünstlerInnen wird die Beschäftigung mit den historischen Materialmassen geradezu erwartet. Es gibt Kontroversen darüber, wie der Wettbewerb für »YouTube Play: A Biennial of Creative Video« zu bewerten ist, den das Guggenheim Museum zusammen mit der Google-Tochter YouTube veranstaltet. Anliegen der Avantgarde decken sich mit dem Gros der versammelten Footage. Kunst solle zugänglich werden, genau damit gibt es auf YouTube ein Problem. Denn der Unterschied zwischen Kunstvideo und Werbeclip, Musikvideo oder Animation wird dort so nicht gezogen. Das ist in den Videotheken, wie sie etwa der Neue Berliner Kunstverein betreibt, einfacher. Aber sie können nur lokal genutzt werden. Das hat zum einen finanzielle Gründe, aber auch Copyright-Gründe, was letztlich auch wieder auf finanzielle Gründe hinausläuft. Deswegen ist »YouTube Play« Museumsausstellung und YouTube-Channel, aber kein »revival of a long lost tradition«, wie Jennifer Allen in »Frieze« schreibt.6 Es gibt noch eine zweite Antwort, denn die Veranstaltung bedient auch den Kreativitätsruf der Kulturindustrie. Kreativität bedeutet dort alles Affirmative, Positive. Produktion ist komplett positiv besetzt. Heißt das, dass Negativität bzw. Kritik für die Offline-Räume der Kunst reserviert bleibt? Hätte das Guggenheim Museum vor 20 Jahren einen Kooperationspartner gesucht, wäre die Wahl auf MTV gefallen – die Inszenierung der Eröffnungsveranstaltung erinnert in ihrer überladenen Medialität an die Verleihung der MTV Awards und wirkt daher wie ein großes Missverständnis der spezifischen Eigenschaften der neuen Referenzkultur.
Als Andy Warhol zur Videokamera griff, kostete eine Kamera noch gut 3.000 Dollar – definitiv zu viel Geld für die AmateurInnen, die heute mit ihren Mobiltelefonen kurze Clips aufnehmen und online stellen. Niedrige Produktionskosten unterschieden trotzdem Warhols kleine Kunstfilme von den Hollywoodproduktionen. Wie er die Kamera einsetzte, machen es heute Millionen von AmateurInnen. So ist es auch nachvollziehbar, dass Warhol sich seinerzeit wie »Alice im Wunderland« vorkam. Die Technik ließ sich so leicht bedienen, dass er immer wieder betonte: Das kann jeder. Die Videokamera für zu Hause oder den Urlaub ist schon lange auf dem Markt. Immer noch neu sind aber die Vertriebskanäle via YouTube. Wie bei vielen AmateurInnen heute war Warhols Ansatz damals, »nur zu gucken, was in zwei Stunden so passiert«; wobei zwei Stunden der damaligen Zeit zehn Minuten auf YouTube entsprechen.
YouTube und TV
Als das Fernsehen seine beste Zeit hatte, in den 1970er-Jahren, kritisierten VideokünstlerInnen die Macht des Fernsehens, sein Publikum in KonsumentInnen zu verwandeln. Richard Serra und Carlota Fay Schoolman haben das 1973 noch exklusive Medium Video benutzt, um ihre Kritik zu formulieren. »Television Delivers People« kritisiert mit Humor, was Pessimisten wie dem Kulturtheoretiker Neil Postman erst in den 1980er-Jahren Sorgen bereitete. Serra und Schoolman machen aus der Banalität des TV-Programms eine Satire, in dem sie zu Fahrstuhlmusik kritische Slogans wie »the product of television is the audience« über den Bildschirm laufen lassen.
Mit der Popularität von YouTube entstehen wieder neue Probleme, was das Verhältnis von Medium und ZuschauerInnen betrifft. Passive FernsehzuschauerInnen werden hier zwar in aktive NutzerInnen verwandelt. Das Paradoxe ist aber, dass die NutzerInnen kommerzielle Medien im Kontext eines privatwirtschaftlichen Mediums unterwandern. Dafür leisten sie Stunden unbezahlter Arbeit.
Kristoffer Gansing, der zukünftige Leiter der transmediale, erkannte diese neuen, aber in manchen Punkten nicht so abweichenden Bedingungen und aktualisierte die Serra-Schoolman-Kritik in seinem Video »YouTube delivers YOU«.7 Darin heißt es: »The New new media state is predicated on media subjectification« und »soft detournement is considered entertainment«. Dies unterstreicht, dass der Internetnutzende KonsumentIn, ProduzentIn und das Produkt selbst ist in einer Person.
Back to the start
Einen Künstler gab es bei der 6. Berlin Biennale, der so schon lange vor YouTube operierte, sich eindeutig an Popkultur orientierte und in Warhol-Manier einfach drauflos hielt. Der obsessive Videofilmer George Kuchar nutzt seit über 20 Jahren profane Effekte aus dem Unterhaltungsfernsehen und überführt so den »Lärm« der Konsumkultur in eine absichtlich dilettierende eigene Arbeitspraxis. Genau das passiert seit wenigen Jahren auf YouTube. Nur dass die Mehrheit der aktiven NutzerInnen Kuchars bedingungsloses und gut gelauntes Œuvre vermutlich nicht kennt.
Vielen Dank an Rosemary Heather und Karolin Meunier für Kommentare zu diesem Text.
1 Vgl. Lawrence Grossberg, Linke und rechte Gegenkulturen, in: springerin 3/2010, S. 18–24.
2 http://petracortright.com/vvebcam.html
3 Dirk von Gehlen in einem Telefongespräch am 12. November 2010.
4 http://www.coryarcangel.com/things-i-made/dreiklavierstucke/
5 http://vimeo.com/8719269
6 Jennifer Allen, Videostore: The dematerialization of the moving image, in: Frieze, Issue 134, Oktober 2010, S. 23.
7 http://www.youtube.com/watch?v=ZTlYJ8EWMgo