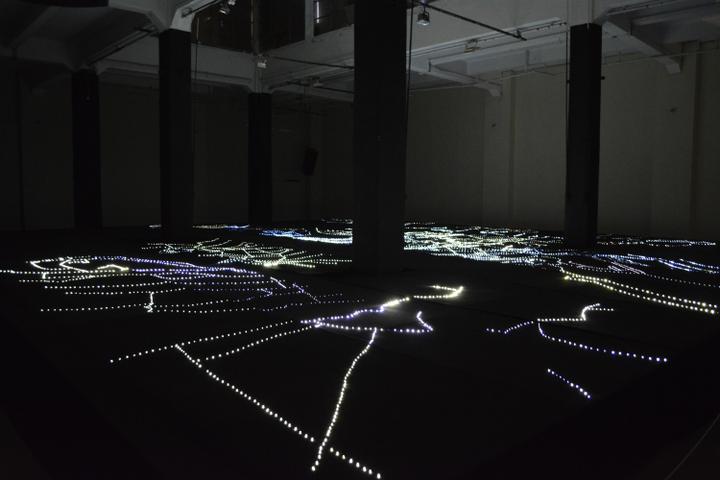Heft 3/2014 - Arab Summer
Arabischer Frühling und „Islam“
Konterrevolution mit geänderten Vorzeichen
Eine Konferenz an der Indiana University in Bloomington im März 2013 gab mir das erste Mal die Chance, eine Diskussion über eine Fragestellung zu führen, die mich schon länger grübeln ließ. Ein Podiumsteilnehmer präsentierte eine These über Gouvernementalität und die Struktur der Islamophobie in der Türkei. Befremdlich? Oder doch nicht? Es ist eine Sache, sich mit dem Phänomen der Islamfeindlichkeit in der westlichen Hemisphäre auseinanderzusetzen, wie ich es seit mehr als einem halben Jahrzehnt nun schon tue. Der Westen hat seine muslimischen Minderheiten, und diese Minderheitensituation geht meist einher mit einer sozioökonomischen und politischen Marginalisierung. Aber kann man auch in einem muslimischen Mehrheitsland von Islamophobie sprechen? In Ländern, bei denen im Westen eher von „Christenverfolgung“ gesprochen wird? Falls doch, dann womöglich mit Einschränkungen? Oder zumindest mit Unterschieden zu Europa? Es stellte sich heraus, dass der Arabische Frühling und hier besonders die Konterrevolution, allen voran in Ägypten, ein Beispiel für die Übernahme westlicher islamophober Sprechweisen liefer(te)n.
Bleiben wir noch kurz bei der Türkei. Es war im Frühjahr 2012, als einige KollegInnen der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule von einer gemeinsamen Reise mit ihren muslimischen KollegInnen der Islamisch Pädagogischen Hochschule in Wien (IRPA) zurückkehrten. Überwältigt von der Gastfreundschaft, der Architektur und dem guten Essen berichteten sie von einer Episode, die im Zusammenhang mit der oben gestellten Frage aufschlussreich zu sein schien. Während einer Führung an einer privaten christlichen Eliteschule in Istanbul sprach eine dort ansässige Person davon, dass die türkischen SchülerInnen auf einen „Islamhass gedrillt würden“. Die LehrerInnen waren bestürzt über diese Aussage. Noch dazu in einem Land, das bis zum Jahr 1453 den Sitz des Orthodoxen Christentums beheimatete und in dem eher die „Unterdrückung von ChristInnen“ im Zentrum kirchlicher Berichterstattung zu stehen pflegte. Einen ähnlichen Tenor hatte auch der eingangs angesprochene Vortrag an der Indiana University. Er präsentierte Atatürk und seine Einheitspartei als eine politische Macht, die in ihrer Verliebtheit mit dem säkularen Frankreich eine tiefe Abneigung gegenüber dem Islam zum politischen Programm erhob und die Religion zunächst auszumerzen versuchte, sie sich später aber in geschwächter Form staatlich einverleibte. Mit Sicherheit ist die türkische Erfahrung eine genuine, die nicht zuletzt auch damit zusammenhing, dass es in der Türkei keine Kolonialbesatzung gab – etwas, das sich in den meisten arabischen Ländern völlig anders gestaltete.
Kein arabischer Führer in der postkolonialen Phase der Unabhängigkeitsbestrebungen – mit Ausnahme von Tunesien – wäre jemals ohne eine Spur von Islamizität in seinem rhetorischen Repertoire ausgekommen. Seien dies der sozialistische und panarabisch orientierte Gamal Abdel Nasser oder der panafrikanisch eingestellte Muammar al-Gaddafi mit seinem grünen Buch. Die Berufung auf den „Islam“ war in der revolutionären Phase gegen die Kolonialmächte Teil des Bezugssystems. Gleichzeitig hatten sich viele der neuen Herrscher mit ihren islam(ist)ischen Oppositionen auseinanderzusetzen. Diese bezogen sich noch viel mehr als sie selbst auf den „Islam“ als ein holistisches Lebenssystem, meist als dritte Kraft neben Kommunismus und Kapitalismus. In Anlehnung an den israelischen Historiker Emmanuel Sivan ließe sich hier eher von einem „Clash within Islam“ sprechen als vom „Clash of Civilizations“. Geht es doch mehr darum, wer in der arabischen Welt authentischer „den Islam“ repräsentieren könne. So haben die 50 handverlesenen AutorInnen der ägyptischen Militärführung in der neuen Verfassung den Islam als offizielle Religion und die Scharia als die erste Quelle der Verfassung beibehalten, was immer das in der Praxis heißen mag.
Jedenfalls liegt genau in dieser mobilisierenden Kraft des „Islams“ eine Quelle von Auseinandersetzungen, die man im Arabischen Frühling auf allen Seiten beobachten konnte. Gleichzeitig veranschaulichen diese Vorgänge die selektive Rezeption des Gespensts des islamistischen Terrors entlang geopolitischer Interessen in der westlichen Berichterstattung.
Denn obwohl der Arabische Frühling kein islamischer Frühling war, bildete der Bezug auf Islamizität von Anbeginn einen Bestandteil der Revolution. Sei es im Freitagsgebet, bei dem sich Millionen Menschen auf dem Tahrir-Platz versammelten, oder in den wiederkehrenden „Fatawa“ (Mehrzahl von „Fatwa“, islamische Rechtsprechung), die etwa Demonstrationen gegen das Herrscherhaus in Saudi-Arabien als islamisch illegitim disqualifizierten. Hingegen bedienten sich islamische Bewegungen (während der ersten Revolution wurden sie als moderate islami(sti)sche Organisationen charakterisiert) eher eines scheinbar „säkularen Vokabulars“. Dieses war insofern säkular, als explizite Bezüge zum Islam kaum je im Vordergrund standen. Dass die von der Revolution eingeforderte Gerechtigkeit aber auch eine zentrale Bedeutung im islamisch-politischen Denken hat, verursachte gewisse „Übersetzungsfehler“ im Westen. Derartige Deutungen spiegeln im Wesentlichen westliche Sozialisation und Denkweisen wider und verdecken, dass die säkulare Grammatik – im Anschluss an Talal Asads Anthropologie des Säkularismus – auch eine kognitive Ausgrenzung mit sich bringt, aufgrund derer sich nur schwer erkennen lässt, was für Menschen aus anderen Regionen und Kulturen bedeutungsvoll scheint.
Nachdem in Ägypten, Libyen und Tunesien die dortigen Scheindemokratien von verzweifelten, erzürnten und mutigen Menschen – meist geführt von gut ausgebildeten Jugendlichen – hinweggefegt wurden, gab sich die westliche Berichterstattung scheinbar überrascht, dass in weiterer Folge meist islamische Parteien an der Wahlurne dominierten. Schließlich handelte es sich um die ersten tatsächlich freien Wahlen, und es schien eine neue demokratische Ära anzubrechen. Wie aber sollte mit den neu gegründeten islamischen Parteien umgegangen werden?
Mit der 2013 einsetzenden Konterrevolution in Ägypten war das kurze Frohlocken, der demokratische Atem der Freiheit, der dem Volk Hoffnung auf Selbstdeterminierung ihrer eigenen Zukunft gab, auch schon wieder beendet. Auch wenn sich in Tunesien eine pragmatische Politik schlussendlich durchsetzte und die islamische Partei als stärkste Kraft einen gemeinsamen Weg mit den restlichen Parteien – basierend auf vielen politischen Kompromissen – beschritt, so stellt ich die Lage in Ägypten, mit 80 Millionen EinwohnerInnen das geopolitisch bedeutendste Land der Region, gänzlich anders dar.
Gerade in Ägypten offenbarte sich eine tiefe Spaltung, nicht zwischen den IslamistInnen und dem Rest, sondern vielmehr zwischen der Muslimbruderschaft und dem Rest (die salafistische Al-Nour-Partei unterstützte den Militärcoup). Während die Muslimbruderschaft in ihrem Geburtsland die Parlamentswahlen wie auch die Präsidentschaftswahl – Zweitere nur knapp – für sich entscheiden konnte, sollte ihr politischer Alleingang, gepaart mit einer tiefen ideologischen Spaltung, die Konterrevolution einläuten. Der Rest ist bekannt. Der erste demokratisch frei gewählte Präsident wurde vom Militär, das sich zur Volksvertretung stilisierte, geputscht. Seine Partei, die demokratisch von einer Mehrheit gewählt wurde, wurde als Terrororganisation eingestuft. Eine Unzahl an Protestierenden wurde im Zuge der Gegenproteste erschossen. Mindestens 16.000 Menschen wurden verhaftet. Und 529 zum Tode verurteilt. Es ist dabei zweitrangig, ob die Politik des Mohammed Mursi von Fähigkeit oder Unfähigkeit zeugt, ob sie eher liberale oder illiberale Züge trägt. Die Tatsache, dass das erste Mal in der Geschichte Ägyptens seit der Unabhängigkeit 1952 das oberste Amt des Staats frei gewählt wurde und das gewählte Oberhaupt sogleich vom Militär gestürzt wurde, liest sich wie ein Freibrief für jede erneute Ermordung des demokratischen Willens, wenn dieser den etablierten Kräften, sprich dem Militär, das die Stütze der Diktatur seit 1952 war, nicht genehm scheint. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass eine Revolution nur dann eine Revolution sein kann, wenn das Militär entmachtet wird. Die pragmatische Inklusion des Militärs durch Mursi war im Nachhinein betrachtet der erste Schritt zum Selbstmord. Es kann als Zeichen der Paradoxie gelesen werden, dass ausgerechnet die Fernsehsendung des Komikers Bassem Youssef, ein scharfzüngiger Mursi-Kritiker, unter der Militärherrschaft von al-Sisi de facto abgesetzt wurde, zumal die Militärherrschaft wenig Geduld für die Kritik am politischen Establishment aufzubringen weiß.
Zurück aber zur eigentlichen Frage, nämlich der Rolle von Islamizität in den Diskursstrategien des konterrevolutionären Militärs: Jahrzehnte zeichnete Mubarak auf der Ebene internationaler Politik das Feindbild der ägyptischen Ayatollahs. Würden die Muslimbrüder an die Macht kommen, so seine Argumentation, dann wäre es aus mit dem ägyptisch-israelischen Friedensvertrag und generell auch mit der Demokratie. Einmal an der Macht würden sie nie wieder von dieser loslassen und dabei ein dunkles Herrschaftssystem der Unterdrückung und des religiösen Fundamentalismus errichten. Gerade aber diese Projektion offenbarte sich als Realität des al-Sisi-Regimes.
Während manche Fundamentalisten der Aufklärung wie Hamed Abdel-Samad den Militärputsch in Ägypten als Verteidigung der liberalen Gesellschaft deuteten, übersahen viele Kommentatoren geflissentlich die Politisierung der Religion zur Legitimierung militärischer Gewalt. Das begann bereits mit dem live im Fernsehen übertragenen Putsch gegen den ersten frei gewählten Präsidenten. Dieser erfolgte vor einer Kulisse, die unter anderem von koptischen und muslimischen Würdenträgern geschmückt war. Im Anschluss daran wurde eine Reihe prominenter Persönlichkeiten aus dem religiösen Establishment vom ägyptischen Militär in die Öffentlichkeit geschickt, um das blutige Vorgehen des Sicherheitsapparats gegen ihre religiösen Gegenspieler religiös zu legitimieren. Die Verfassungsnovelle von 2014 wurde von der historisch ältesten islamischen Universität der Welt, der Al-Azhar in Kairo, und der Koptischen Kirche unterstützt, deren Vertreter sogar Lobgedichte auf al-Sisi sprachen. Ein dort Lehrender meinte gar, al-Sisi sei von Gott geschickt, um das ägyptische Volk vor der Muslimbruderschaft zu retten.
Ali Gum’a, ehemals Mufti von Ägypten, hielt kurz nach dem Militärcoup eine 30-minütige Ansprache vor Soldaten, in der er das Töten von DemonstrantInnen legitimierte: „Wenn jemand kommt, der euch zu entzweien versucht [...], dann tötet ihn, wer immer er auch ist“. Gemeint waren die AnhängerInnen der Muslimbruderschaft, die im staatlichen wie im staatsnahen Fernsehen als „TerroristInnen“ gebrandmarkt wurden.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt auch die Predigt des ehemaligen „Popislamisten“ Amr Khaled, der zuvor in Großbritannien gelebt hatte und im Westen eher als Bote des interreligiösen Dialogs bekannt war. Für Khaled dienten die Soldaten nicht dem Kommandeur, sondern Gott selbst, hieß es in seiner Rede. Den militärischen Vorgesetzten zu gehorchen sei eine göttliche Pflicht. Zwar kursierten online Diskussionen über den Kontext der Entstehung der Videoaufzeichnungen, nicht aber über deren Verwendung.
Viel wichtiger für den politischen Prozess in Ägypten war die Tatsache, dass das Militär Persönlichkeiten aus dem religiösen Establishment einspannte, um die Tötung von DemonstrantInnen zu legitimieren. Manche BeobachterInnen lasen aus diesem Manöver eine krisenhafte Stimmung innerhalb des Militärs auf Ebene der Soldaten heraus. In der Militärführung herrsche Furcht vor Illoyalität in den eigenen Reihen. Auch in Ägypten, das für seine Volksgläubigkeit bekannt ist, schien das Vorgehen des Militärs also nicht nur mit säkularen und politisch-ideologischen Vokabeln legitimierbar. Eine Radikalisierung des religiösen Diskurses zur Legitimierung der Niederschlagung der Opposition folgte. Die Muslimbruderschaft seien die „khawarij“ unserer Zeit, verlautbarten manche Geistliche an der verstaatlichten islamischen Universität Al-Azhar wie auch Ali Gum’a. Damit nahm das Regime al-Sisi Bezug auf die frühislamische Geschichte, in der – verkürzt gesagt – eine Horde puritanischer Eiferer Gewalt und Zerstörung in der muslimischen Gemeinde verbreitete. Dieser Topos ist ein uralter, der bereits in den 1950er-Jahren gegen die Häupter der Muslimbruderschaft ins Feld geführt wurde. Paradoxerweise sollten gerade die Muslimbrüder in den 1990er-Jahren im Dienste des Mubarak-Regimes terroristische Vereinigungen wie die Jihad-Gruppe in den Gefängnissen zum gewaltlosen Islam bekehren. Damals war das Mubarak-Regime noch sattelfest an der Macht und konnte die Muslimbruderschaft im Zaum halten. Dass in der Zeit der Mursi-Regierung gerade einer der Führer einer ehemals militanten Gruppe zum Gouverneur von Luxor ernannt wurde, führte zu einem Aufschrei. Gewiss hätte dies auch – aus historischer Perspektive – als Beweis herangezogen werden können, dass ehemals gewalttätige Segmente der ägyptischen Gesellschaft erfolgreich in das System integriert worden seien. Dies wäre gewissermaßen in Kontinuität zur Mubarak-Ära gestanden. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Spieß in der Öffentlichkeit bereits gedreht. Die Uhr der demokratisch gewählten „moderaten Islamisten“ war abgelaufen.
Was in dieser Phase besonders auffällig war, ist die kaum vorhandene Reaktion westlicher Medien und das Schweigen westlicher PolitikerInnen. Man stelle sich vor, eine Frau wäre während Mursis Amtszeit gesteinigt worden. Oder die Muslimbruderschaft hätte Menschen während der Demonstrationen gegen Mursi ermordet. Welchen Aufschrei hätte es da – zu Recht – in der westlichen Hemisphäre gegeben! Allein der Polizeieinsatz gegen die Taksim-AktivistInnen hatte Erdogan bereits zu einem „bad guy“ gemacht. Im gegebenen Fall wurden aber Hunderte friedliche DemonstrantInnen auf den Straßen ermordet, in mehreren Phasen insgesamt mehr als 1.000 Personen erstinstanzlich zum Tode verurteilt. Gerechtfertigt wurde dies unter anderem mit einem radikalen islamistischen Diskurs seitens des Militärregimes, um die gefürchtete Muslimbruderschaft aufzuhalten, die Ägypten laut der Propaganda des jetzigen Regimes angeblich in einen Iran 2.0 verwandeln wollte. Dass die jungen AnführerInnen der Revolution, die 6.-April-Bewegung, die sich gegen Mubarak, Mursi und dann al-Sisi formiert hatte, heute ebenso im Gefängnis sitzen, scheint in einem Meer der Bedeutungslosigkeit unterzugehen. Die Vereinigten Staaten wie die EU verhielten sich zu Beginn zögerlich, um bald nach der Konsolidierung der Macht das al-Sisi-Regime – diplomatisch höchst vorsichtig, aber realpolitisch massiv – zu stützen. In der Zwischenzeit sind die kurz ausgesetzten finanziellen Militärhilfen an Ägypten von den USA teilweise wieder aufgenommen worden. Ohnehin hatte John Kerry die Roadmap zur Wiederherstellung der Normalität im Juli 2013 deutlich als „den richtigen Weg der Ägypter“ benannt. Die Rückkehr zu freien Wahlen bedeutete schließlich nach dem Verbot der Muslimbruderschaft ein Zurück zur Wahl der Marionetten des Militärs. Al-Sisi machte dies ganz unverblümt, indem er sich bei der Präsidentschaftswahl als Kandidat aufstellen ließ. In einer derart grotesken politischen Unkultur schien nichts mehr unmöglich.
Dabei bemühte das al-Sisi-Regime – das Militär sowie das staatliche wie auch das bedeutendste private Fernsehen – Verschwörungstheorien, die die Muslimbruderschaft in Kollaboration mit den USA, dem Zionismus, Israel und dem Rest der Welt porträtierten. Das Militär gab demnach vor, gegen die „Islamisierung“ der Bruderschaft vorgehen zu müssen. Begriffe aus dem islamophoben Repertoire des Westens wie „Islamofaschismus“ (so der US-amerikanische Kolumnist und Autor Norman Podhoretz) wurden für dieses Schreckensbild verwendet. Was die Welt erlebte, waren aber eine „Islamisierung“ und ein „Faschismus“ unter ganz anderen Vorzeichen. Das scheint die westlichen MachthaberInnen wenig zu kümmern. Jedenfalls scheint das Jahrzehnte anhaltende Credo der USA, „Stabilität vor Demokratie“, aufrecht zu bleiben.
Es wird vermutlich nur eine Frage der Zeit sein, wie lange die Millionen Menschen, denen es an Arbeit und Brot fehlt, ihre verlorene Angst wiederentdecken, den Missbrauch der Religion aufdecken, erneut auf die Barrikaden steigen, um das nächste Unrechtsregime zu beseitigen und so, wie man in Anschluss an Frantz Fanon sagen könnte, ihre Menschlichkeit wiederentdecken.