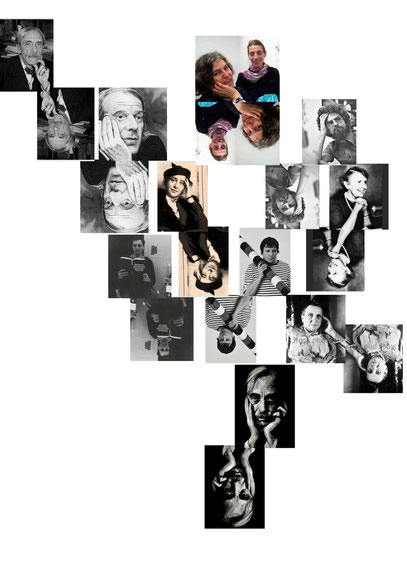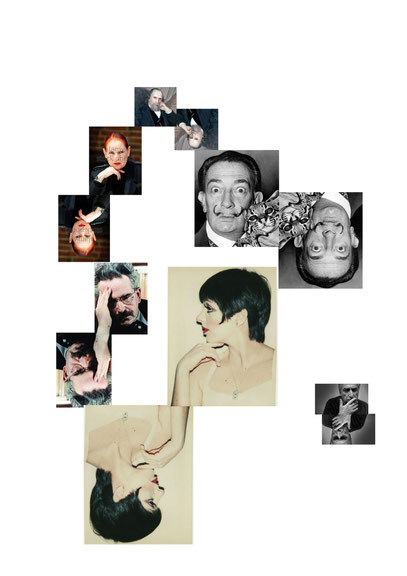Zeitgenössische Formen von Gesellschaft, Kultur und Kunst scheinen sich in einem permanenten Zustand der Krise zu befinden. Es fällt sogar schwer, sich etwas vorzustellen, das nicht in einer Krise wäre. Doch gerade diese Allgegenwärtigkeit von Krise macht es gleichzeitig nicht einfach zu sagen, worin eigentlich ihre wesentlichen Merkmale liegen, wovon sie abzugrenzen und wie ihr zu begegnen ist. Was also ist eine Krise? Ich werde versuchen, mich dieser gleichsam ontologischen Frage von vier Seiten her zu nähern, um im Anschluss daran die historischen, epistemologischen und politischen Konsequenzen der jeweiligen Antworten besser diskutieren zu können.
Die erste Annäherung betrifft die Frage nach dem objektiven oder subjektiven Charakter einer Krise. Häufig wird der Begriff der Krise benutzt, um zumindest indirekt eine objektive Beschreibung eines – an sich idealen, harmonischen – Zustands zu liefern, der aus den Fugen oder in Unordnung geraten oder gar durch ein katastrophisches Ereignis in seiner Existenz bedroht ist. Diesem Verständnis zufolge wurzelt der Begriff der Krise in der Natur der Dinge selbst, beispielsweise in den historischen Bedingungen des Kapitals und der dadurch definierten sozialen Verhältnisse, oder im Prozess einer Entfremdung der Kultur von sich selbst, verursacht durch eine instrumentelle, ausschließlich an Nutzen und Verwertbarkeit interessierten Vernunft. Solche objektiven Verortungen der Krise bleiben jedoch stets auch auf ein subjektives Moment angewiesen, das sich in den besonderen Sprechakten der Diagnose, der Kritik oder auch eines versöhnenden Ausblicks zeigt. In dieser Hinsicht erscheint Krise als ein Beschreibungsmodus voller idealistischer Voraussetzungen und Dringlichkeiten, als eine rhetorische Trope, die stets ein wissendes Subjekt ins Zentrum seiner semantischen und pragmatischen Operationen setzt. Über Krise zu sprechen scheint stets beide Aspekte zu vereinen, und infrage steht daher, wie die objektiven und subjektiven Aspekte der Krise aufeinander bezogen bzw. eben auch nicht bezogen werden können.
Man kann sich der Frage, was eine Krise ist – das wäre die zweite Annäherung –, auch über die Unterscheidung zwischen ihrer Singularität und ihrer Pluralität nähern. Gibt es eine Krise oder deren viele? Und besteht dementsprechend eher eine Einheit oder eine Vielheit ihrer Erscheinungsformen? Von einer Krise zu sprechen impliziert, ein grundlegendes Prinzip der Verursachung anzunehmen, etwa die Kapitalverhältnisse oder die Warenform, die Rationalität und Individualität moderner Seinsweisen, oder die Moderne insgesamt in ihren technologischen, politischen und kulturellen Dimensionen. Von einer Vielfalt an Krisen auszugehen kann hingegen sowohl die Vielheit von Symptomen bei immer noch einer Wurzel der Verursachung meinen oder eben die Vielfalt der Gründe selbst, was wiederum die Idee sozialer und kultureller Differenzierungen der Moderne in weitgehend autonome Subsysteme voraussetzt, die unabhängig voneinander gedeihen, aber auch in die Krise geraten können. Die Frage wäre dann, wie diese Sphären miteinander in Beziehung gesetzt werden können, wie das „Gedeihen“ des einen Bereichs, etwa der Ökonomie, sich auf die Krise in einem anderen, dem Sozialen, der Kultur oder der Ökologie, auswirkt.
Von einer dritten Seite her kann man die räumlichen und zeitlichen Dimensionen der Krise zu ermessen versuchen. Ist die Krise ein eher lokales oder ein globales Phänomen? Ist sie vorübergehend oder permanent? Dieser Zugang betrifft nicht nur die geografischen bzw. geopolitischen Aspekte zwischen Zentrum und Peripherie, sondern auch die Frage, wie Lokalität im globalen Rahmen überhaupt gedacht werden kann – als hierarchische Ansammlung oder als egalitäre Ausbreitung, als Reihe bzw. Raster oder als Netzwerk? Ebenso betreffen die geschichtlichen bzw. chronopolitischen Aspekte nicht nur die Verhältnismäßigkeiten zwischen Fortschritt und Rückschritt, sondern die temporale Dimension von Politik selbst. Gerade diese zeitliche Dimension lässt sich unmittelbar auf die Vorstellungen, wie wir mit Krise oder Krisen zurechtkommen können, beziehen. Ist die Krise etwas, das überwunden werden muss bzw. kann – und somit bloß einen Abschnitt auf unserem Weg zurück in einen harmonischen Zustand darstellt? Oder ist sie etwas, das wir zu akzeptieren lernen müssen als eine der kategorischen Bedingungen moderner Existenzweisen?
Als vierte Herangehensweise lässt sich schließlich die Frage nach dem Wert bzw. der Bewertung der Krise stellen. Ist Krise im Wesentlichen ein negativer Begriff oder gibt es eine Möglichkeit, ihn auch positiv zu fassen? Die Negativität wird meist umstandslos vorausgesetzt, und doch gibt es zumindest zwei Vorstellungsweisen, in denen eine Positivität des Begriffs implizit vorausgesetzt wird. Die eine betrifft soziale Formen, die wie im Fall des Besitzindividualismus, der Kleinfamilie, der traditionellen Geschlechterrollen oder des Nationalstaates innerhalb kritischer Diskurse negativ bewertet und deren Krise daher im Umkehrschluss nur positiv verstanden werden kann. Die zweite Vorstellung einer Positivität der Krise setzt grundsätzlicher an, und zwar in dem Sinn, dass immer etwas in die Krise geraten muss, um Veränderung überhaupt denken zu können. Jede Vorstellung historischer Prozessualität bedingt ein krisenhaftes oder kritisches Moment, das sich erst im Gesamtzusammenhang des Prozesses als ein produktives erweisen kann. Die Frage der Bewertung hängt dann davon ab, wie der Prozess selbst verstanden und bewertet wird.
Wichtig scheint mir insgesamt, die intrinsische Ambivalenz des Krisenbegriffs im Hinblick auf den Wertaspekt zu betonen. Hinzu kommt, dass Krisen nicht von allen in der gleichen Weise erlebt und erfahren werden. Einige profitieren von Krisen, insbesondere die Medien, deren besonderes Lebenselixier sie zu sein scheinen, während andere schwerst unter ihnen leiden. Und viele von uns reagieren auf kulturelle, ökonomische und soziale Krisen mit einer weiteren Form von Krise: einer persönlichen und psychologischen Krise, die sich in den Phänomenen der Depression, des Burn-outs oder der Persönlichkeitsspaltung niederschlagen kann.
Auf allen diesen Ebenen lassen sich sowohl klare Gegensätze des Krisenverständnisses als auch bestimmte Verbindungen zwischen diesen Gegensätzen erkennen. Das Objektive und das Subjektive, die Einheit und die Vielheit, die Lokalität und die Globalität, das Transitorische und die Permanenz und schließlich die Positivität und die Negativität stehen einander gegenüber, bedingen einander aber auch. Gleichzeitig kann es zu unterschiedlichen Verknüpfungen der verschiedenen Ebenen kommen, sodass etwa das Subjektive, Lokale, Multiple und Transitorische dem Einheitlichen, Globalen, Objektiven und Negativen gegenübersteht. Doch zweifellos sind unterschiedlichste Verknüpfungen denkbar, und die Frage lautet, wie wir diese Verknüpfungen und Trennungen, Beziehungen und Nicht-Beziehungen denken können.
Der Vorschlag, den ich hier anbieten möchte, lautet folgendermaßen: Krise ist nicht als ein Mangel an Form zu begreifen, sondern vielmehr als eine ganz spezifische historische Form. Es ist genau dieser formale Aspekt, an dem sowohl die genannten Differenzen als auch die möglichen Verbindungen festgemacht werden können. Erst innerhalb eines Verständnisses von Krise als Form werden die verschiedenen Ebenen voneinander und in ihrer je spezifischen Gegensätzlichkeit unterscheidbar, und gleichzeitig können diese Gegensätze auch aufeinander bezogen werden. Was aber ist eine Form? Der Begriff der Form soll hier weder im Sinne einer essenziellen Idee oder Qualität der Dinge – wie in der aristotelischen Tradition – noch als Oberflächenerscheinung wie in der formalistischen Kunsttheorie aufgefasst werden. Viel eher geht es um jenen sozialtheoretischen Formbegriff, wie er von Niklas Luhmann im Anschluss an George Spencer-Brown entwickelt wurde. Dieser Formbegriff meint nicht die konkreten sozialen, psychologischen, kulturellen oder politischen Formen selbst; er setzt vielmehr an den Akten der Unterscheidung an, die jede Form vornehmen muss, indem sie etwas abgrenzt, das nicht als ihr zugehörig betrachtet werden soll. Der Begriff der Krise lässt sich historisch gewissermaßen als eine solche Außenseite der Form betrachten, da er stets nur im unmittelbaren Zusammenhang mit den Formen des Sozialen, Kulturellen, Ökonomischen oder Politischen aufgetreten ist. Gerade indem er die Außenseite der Form verkörpert, ist er jedoch immer schon Teil der Form und ihrer Unterscheidungsprozeduren. Es ist diese grundsätzliche Zweiseitigkeit der Form, in der die Un- oder Antiform also immer schon zur Form gehörig verstanden werden kann.
Als spezifische historische Form, das heißt als ein bestimmter Modus der kulturellen Selbstbeschreibung und Selbstversicherung wurde der Begriff der Krise im Lauf des 18. Jahrhunderts entscheidend geprägt. Er ist daher direkt mit dem Aufkommen der großen Kategorien des modernen Symbolischen – Geschichte, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kapital, Politik – verbunden, und zwar stets in enger Verknüpfung mit dem Begriff der Kritik. Wie Reinhart Koselleck gezeigt hat, ist es der Begriff der Kritik, der diese Begriffssingulare erst hervorbringt, indem er sie aus der Fülle der pluralen Geschichten, Gesellschaften, Kulturen, Künste, Ökonomien und Politiken heraushebt, verallgemeinert und als substanzielle Zielhorizonte konkreter Praktiken wie Ideen ausweist. Indem die Kritik also die Kriterien für das schärft, was einen singularen Allgemeinbegriff ausmachen sollte und gleichzeitig dessen konkrete Realisierung oder identitäre Schließung verhindert – weil jeder praktische Beanspruchungsversuch stets von Neuem kritisiert werden kann –, etabliert sich Kritik selbst als die eigentlich neue Macht. Sie usurpiert deren souveräne Position, und in ihrem Windschatten kann sich die Krise als eigene Form ausbreiten. Krise entwickelt sich also zunehmend von der Außenseite der großen symbolischen Formen der Moderne hin zu einer eigenen symbolischen Form und produziert derart selbst neue Abgrenzungen und Negativformen, die sie in ihrer inhaltlichen Eindeutigkeit wiederum infrage stellen.
Krise als Form zu begreifen – und somit als rhetorische und literarische Trope, als spezifische symbolische Form der Moderne – heißt jedoch keineswegs, dass deshalb Krise als Form einer wie auch immer gearteten Vorstellung von Krise als Realität gegenübergestellt werden müsste. Ganz im Gegenteil könnte es sein, dass es gerade dieses Verständnis der Krise als besondere, kategorisch zweiseitige Form ist, das es überhaupt erst erlaubt, die Realität von Krisen zu verstehen. Denn gerade dort, wo die Realität nicht einfach empirisch gegeben ist und, wie Brecht sagt, in die Funktionale gerutscht ist, braucht es die subjektiv-interpretierende Intervention als Ausgangspunkt eines Erkenntnisprozesses. Dieser Erkenntnisprozess kann jedoch selbst nicht objektiv sein. Er setzt nicht nur die subjektiven Akte der Diagnostik voraus; die darin erkannte Realität konditioniert das erkennende Subjekt selbst bereits auf vielfältige Weise. Auch wenn die Form der Subjektivität daher grundlegend für jede Erkenntnis von Krisen ist, so bedarf es doch eines Horizonts der Überschreitung der je eigenen Subjektivität, ein subjektives Allgemeines, das die Diagnostik davor bewahrt, weder rein subjektiver Ausdruck noch starres, objektives Schema zu sein. Gerade in der Form der Diagnostik oder Interpretation lassen sich die subjektiven und die objektiven Aspekte aufeinander beziehen.
Krisen zu erkennen scheint mir insbesondere deswegen bedeutsam zu sein, weil es gerade das Ignorieren von Krisen ist, das sich als der gefährlichste Aspekt in ihrer Geschichte erwiesen hat. Die Euphorie, wie sie sich etwa zu Beginn des Ersten Weltkriegs zeigte, wäre in diesem Verständnis der eigentliche Gegenbegriff bzw. das Symptom einer Krise. Die sich darin ausdrückende Ignoranz betrifft nicht bloß eine selektive Wahrnehmung, ein fantasmatisches Genießen oder eine tiefe Verkennung der je eigenen historischen Position, sondern ganz direkt das Ineinanderfallen von subjektivem Gefühl und verstandener Welt. Sowohl in der Euphorie als auch in der reinen Apokalyptik geht jeweils die Form verloren, durch die Krisen einzig erkannt werden können.
Erkenntnis wird daher nur möglich sein, wenn die formalen Funktionsweisen und Narrationen des Krisenbegriffs selbst bedacht werden. Erst in einer solchen Betrachtungsweise als operationale Form können die Unterscheidungs- bzw. Abgrenzungsakte jeder Krisendiagnose ebenso verstanden werden wie die „dialektischen“ Bezugnahmen zwischen den beiden Seiten der Form. Wenn also die objektiven, globalen oder einheitlichen Aspekte stets nur unter der Bedingung subjektiver, lokaler und pluraler Aussageakte erscheinen können und diese umgekehrt selbst wieder objektivierbaren kulturellen Mustern folgen, aus denen sie ihre jeweiligen Motivationsquellen ziehen, dann macht gerade diese strukturelle Verknüpftheit deutlich, dass sich erst im Problem der Form die politische Dimension des Krisenbegriffs zeigt. Denn an die Realität von Krisen kann man nicht von außen, als unbeteiligter Beobachter herantreten. Diese Realität involviert Beobachtung in dem Sinn, dass die die je eigenen Unterscheidungen begründenden Wahrnehmungsweisen und Werthorizonte immer schon als politische Positionierungen verstanden werden müssen. In diesem Sinn gibt es keine Neutralität der Krise. Es reicht allerdings auch nicht, einmal getroffene Unterscheidungen rituell zu wiederholen. Vielmehr müssen Wahrnehmungsweisen und Werthorizonte ständig aktualisiert und sozialisiert werden, um ihr politisches Potenzial auch unter veränderten Bedingungen ausschöpfen zu können.
Damit steht die Form der Diagnose selbst zur Disposition. Denn Zeitdiagnostik ist mit Hegel zum eminenten Geschäft der Philosophie geworden. Ohne eine solche historisch-aktualistische Verortung scheint kein kritischer Diskurs möglich zu sein. Und doch wird Zeitdiagnostik schnell zu einer leeren Formel, wenn ihre formale Dimension als abgrenzender Unterscheidungsakt nicht beachtet wird. Krisen bleiben daher an als aktuell erlebte Ereignishorizonte gebunden; ihre Erkenntnis verlangt jedoch eine Form der Zeitlichkeit, ein Verständnis historischer Prozessualität, das gerade nicht in der Aktualität aufgeht. Erst vor diesem Hintergrund wird ein Ereignis überhaupt als Symptom deutbar. Je starrer die Vorstellungen historischer Prozessualität sind, desto leichter fällt das konkrete Urteil, und je differenzierter Geschichte erscheint, desto schwieriger wird das diagnostische Geschäft. Ein kritischer Krisenbegriff scheint deshalb nur unter der Bedingung verschiedener Abwägungen möglich: Welche Realitäten eröffnen die Sprechakte von Diagnose, Kritik und versöhnendem Ausblick und welche verschließen sie? Was lässt sich als Symptom einer Krise deuten und wann wird die Diagnose selbst zum Symptom? Und welche epistemologischen, ethischen und ästhetischen Dimensionen liegen in der formalen Bedingtheit der Sprechakte von Diagnose und Kritik verborgen? Sind diese Sprechakte letztlich als Voraussetzung jeder Praxis zu begreifen oder sind sie selbst bereits eine besondere Form von Praxis?
Antworten auf diese Fragen setzen voraus, auch die Form der Erzählung und die Frage, wie Einheit oder Vielheit der Krise darin aufscheinen können, zu bedenken. Denn jede Krisendiagnostik impliziert eine gewisse Erzählung darüber, wie sich die Krise historisch etabliert hat. Solche Erzählweisen können wiederum einem eher eindimensionalen oder einem multiperspektivischen Muster folgen. Die „Großen Erzählungen“ der Moderne können etwa als Versuche verstanden werden, den krisenhaften Stand der Dinge durch einen einheitlichen Erzählstrang, der individuellen Ereignissen exemplarischen Sinn zuschreibt, zu überwinden. Diese Überwindungsversuche gelingen jedoch nicht; in ihrer Abfolge zeigen sie vielmehr eine strukturelle Wiederholung an, die in der wechselseitigen Abhängigkeit von Diagnose und Überwindungsanspruch begründet liegt. Das epistemische und produktive Potenzial hingegen an punktuellen Ereignissen festzumachen, setzt ein anderes, multiperspektivisches Narrativ voraus, in dem die Krise nicht notwendigerweise überwunden wird, sondern vielmehr einen symbolischen Raum von Geschichtlichkeit eröffnet, in dem die unterschiedlichen Aspekte des Krisenbegriffs zwischen Subjektivität und Objektivität, Einheit und Vielheit, Transitorik und Permanenz aufeinander bezogen werden können.
Schließlich stellt sich jede Krisendiagnostik auch als praktische Herausforderung im Sinne einer Ethik der Form dar. Rhetoriken der Krise scheinen vielfach zu unmittelbarer Aktion aufzurufen, und jede Aktion folgt bestimmten ethischen Voraussetzungen. Das Problem einer Ethik der Krise stellt sich in dem Moment, wenn weder rein objektive noch rein subjektive Gründe zur Rechtfertigung einer bestimmten Aktion in Stellung gebracht werden können. Ethisch zu agieren bedeutet daher, zwischen Subjektivität und Objektivität, Geschichte und Dringlichkeit, Erzählung und Erfahrung zu navigieren. Die meisten Bezüge auf Ethik schwanken jedoch zwischen einem moralischen Universalismus, der auf einer privilegierten Einsicht in den Zusammenhang der Dinge beruht, und amoralischer Indifferenz, wie sie im Gegenzug viele Avantgarden in ihrem anarchischen Selbstverständnis hochgehalten haben. Demgegenüber wäre eine Ethik des Symbolischen zu diskutieren, die an das Problem der Krise als Form anschließt. Eine solche Ethik muss die Spannungen zwischen Subjektivität und Objektivität, Perspektivismus und Universalismus aufnehmen und die eigene Relativität und Bedingtheit zum Ausgangspunkt nehmen, um die gesellschaftlichen Bedingungen von Krisen zu erkennen und sich im Verhältnis dazu kritisch zu positionieren. Sie bemisst sich derart nicht an einer wie auch immer imaginierten Verantwortlichkeit für die Lösung der Krise, sondern nur im Insistieren auf der formalen Potenzialität des Begriffs.