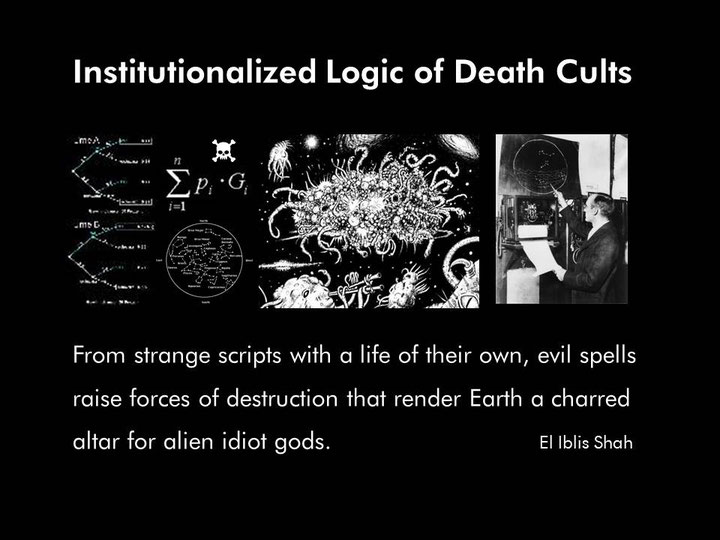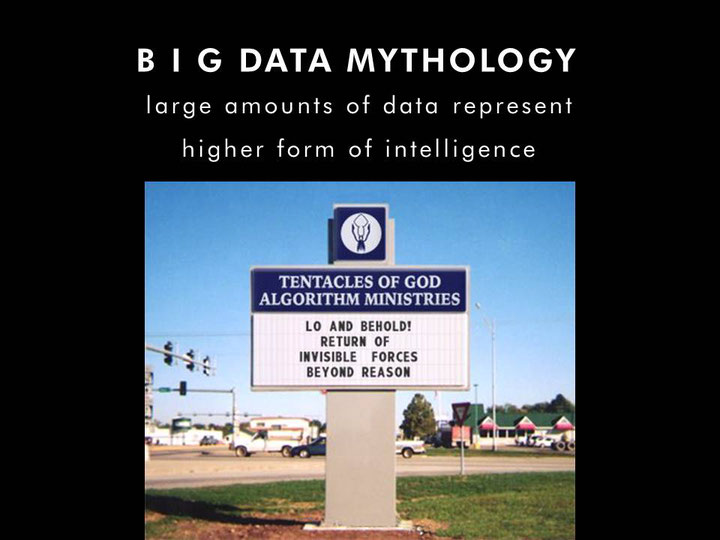Heft 3/2018 - Netzteil
Im tiefen Tal der Cyberüberwachung
Interview mit dem Autor Yasha Levine über die militärischen Ursprünge des Internets und die Probleme seiner demokratiepolitischen Zurichtung
Yasha Levine ist Autor des beim Verlag Public Affairs erschienenen Buchs Surveillance Valley. Als investigativer Journalist und Gründungsredakteur von The eXile veröffentlichte er in NSFW Corp, Pando Daily, The Baffler, Alternet sowie The Nation. Seit Langem verfolgt Levine das Ineinandergreifen von Überwachung, der hyperliberalen Ideologie des „Cyberlibertarianismus“ und der Ausbildung neuer Oligarchien. Darüber hinaus zählt er zu jenen Whistleblowern, die die Rolle des Tor-Projekts für die „sanft-militärischen“ Aktivitäten der USA enthüllt haben.
Olivier Jutel: Wie ist Ihr Buch und seine Hauptthese, dass das Internet im Wesentlichen eine Überwachungsmaschine ist, rezipiert worden?
Yasha Levine: Mein Buch ist zu einem wirklich guten Zeitpunkt erschienen, nämlich genau als sich viele der „dunklen Seite“ des Internets bewusst wurden. Vor Trump war noch alles eitel Wonne, sogar die Manipulation durch Facebook war super, weil sie ja von Obama kam. Surveillance Valley erschien zwei Monate vor dem Skandal von Cambridge Analytica. Alles, was ich schreibe, ist somit nur eine Art Vorwort dazu, wie wesentlich die Manipulation privater Daten für unsere Politik und Wirtschaft inzwischen ist. Im Grunde war das immer schon der Zweck des Internets, seit vor 50 Jahren das ARPANET aufgebaut wurde. Ich hoffe, dass das Buch ein paar Wissenslücken schließen kann, denn die Geschichte des Internets haben wir offenbar, so seltsam es klingen mag, vergessen.
Jutel: Über das Internet wird oft wie über „die Macht“ in Star Wars geredet – so als würde es aus immateriellen Teilchen bestehen. Ihr Buch hingegen erklärt die materiellen, politischen und ideologischen Ursprünge des Netzes. Könnten Sie etwas zu den militärischen Imperativen sagen, denen es dient?
Levine: Als Erstes muss man wissen, dass das Internet als Forschungsprojekt im Zuge des Vietnamkriegs entstand. Die USA waren damals in Sorge, es könne weltweit zu derartigen Aufständen kommen. Das Internet war ein Projekt, dass dem Pentagon dabei helfen sollte, eine weltweite militärische Präsenz aufzubauen, um diese Aufstände niederzuschlagen.
Damals wurden die ersten Computersysteme gebaut, die wie das ARPANET vernetzt waren und zur Frühwarnung vor möglichen sowjetischen Nuklearschlägen dienten. Computer und Radargeräte wurden so miteinander verbunden, dass Analysten auf Bildschirmen in Tausenden Kilometern Entfernung das ganze Staatsgebiet überwachen konnten. Das war insofern neu, als alle vorigen Systeme auf Berechnungen basierten, die von Menschen durchgeführt wurden. Sobald sie automatisiert waren, entstanden ganz neue Vorstellungen von der Welt. Plötzlich konnte man den Luftraum und Tausende Kilometer Grenze von einem Computer aus überwachen. Das war in den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren. Die Grundidee bestand darin, die Computertechnik auf Schlachtfelder und in der Folge auf ganze Gesellschaften auszuweiten.
Eine der Aufgaben, denen das ARPANET in den 1960er-Jahren in Vietnam diente, bestand in der „Schlachtfeldabhörung“, wie man das nannte. Man warf Sensoren über dem Urwald ab [etwa in Gestalt von Tierexkrementen, Anm. O. J.], um damit Truppenbewegungen festzustellen, die man aus der Luft nicht sehen konnte. Diese Sensoren waren kabellos und sendeten Information an ein Kontrollzentrum, wo sie ein IBM-Computer aufnahm. Die von ihm errechneten Truppenbewegungen dienten dann zur Zielauswahl für Bombardements. Dies war der Auftakt für alle elektronischen Grenzschutzmaßnahmen, die dann in die USA rückexportiert und an der Grenze zu Mexiko eingesetzt wurden – und bis heute werden.
Das Internet entstand in diesem militärischen Zusammenhang. Es ist eine Technologie, die verschiedenartige Computernetzwerke und Datenbanken miteinander verbinden soll, die damals von null weg alle mit eigenen Netzwerk-Protokollen und eigener Hardware aufgebaut wurden. Das Internet fungiert als eine universelle Netzwerksprache zum Informationsaustausch zwischen diesen Geräten.
Jutel: Das ideologische Fundament des Internets kommt mir widersprüchlich vor. Einerseits gibt es da die antikommunistische Paranoia, andererseits den superliberalen Optimismus, der freie Informationsfluss könnte das Potenzial des Menschen erst richtig entfalten. Wie sehen Sie diesen Widerspruch?
Levine: Das sieht nur wie ein Widerspruch aus, ist aber keiner. Die Angst vor dem Kommunismus führte zum Internet und beschleunigte auch seine Weiterentwicklung. Aber nur ein winziger Kreis des Militärs glaubte wirklich, dass die linke Politik die ganze Welt einschließlich der USA erobern könnte. Nach Vietnam verschob sich der Fokus der Aufstandsbekämpfung dahin, wie man soziale Unruhen beschwichtigen kann, ohne den Menschen das geben zu müssen, was sie eigentlich wollten.
Als Hauptproblem wurde nunmehr erachtet, dass die Menschen nicht richtig verwaltet wurden – was ihre Sorgen, ihre Ungleichheit, die ungerechte Verteilung der Ressourcen betraf. Dennoch glaubte man nicht, dass Amerika vor einer ideologischen Herausforderung oder einem antikolonialen Kampf stünde, sondern dass man bloß ein verwaltungstechnisches Problem habe.
Und so wurden die Computernetzwerke, aus denen später das Internet werden sollte, und die Information, die sie übertrugen, zu sozialen Sensoren. Endlich konnte man Revolten oder auch nur Unzufriedenheit leicht aufspüren. Diese Information konnte wiederum in Computermodelle gefüttert werden, um damit die mögliche Ausbreitung bestimmten Ideen und Forderungen vorherzusagen. Und dann konnte man sagen: „Okay, die haben dieses oder jenes Problem, geben wir ihnen einfach ein bisschen von dem, was sie wollen“, oder: „Hier ist eine Revolutionsbewegung, von der wir am besten diese oder jene Zelle eliminieren sollten“.
Das Netzwerk diente also zur Verwaltung der Gesellschaft und Schaffung einer utopischen Welt, in der man Konflikte wegmoderieren und ganz ausmerzen konnte. Mit dieser besseren und dezenteren technokratischen Verwaltung sollte es nie mehr zu bewaffneten Konflikten kommen.
Jutel: Da muss ich unweigerlich an Hillary Clintons legendären Tweet über den Niedergang von Flint, Michigan, denken. „Komplexe soziale Probleme“ wie ethnische und ökonomische Unterdrückung sind darin in hübsche kleine Kästchen geschrieben, damit wohlmeinende TechnokratInnen dann in ihren Workshops hübsche kleine Lösungen ausbaldowern können.
Levine: Ja, und all das begann in den 1960er-Jahren. Wenn Sie schon die Demokraten erwähnen: Am MIT arbeitete einst ein gewisser Ithiel de Sola Pool, der als Sozialwissenschaftler ein Pionier der Computermodellierung war, was Umfragen und Simulationen in Wahlkämpfen betraf. Bei seiner Präsidentschaftskampagne 1960 verließ sich John F. Kennedy auf Pool, dessen Modelle den Zuschnitt von Botschaften und Wähleransprache bestimmten. Interessant ist auch, dass Pool später eine wichtige Rolle beim ersten Überwachungsprojekt im ARPANET spielte, im Zuge dessen in den frühen 1970er-Jahren Daten von Millionen KriegsgegnerInnen verarbeitet wurden.
Pool glaubte außerdem, das Problem internationaler wie nationaler Konflikte läge darin, dass die Planenden in den Regierungen und Konzernchefetagen einfach nicht genügend Information hätten. Teile der Welt wären einfach zu undurchsichtig für sie. Eine Chance, um Konflikte zu überwinden und ein perfektes System zu errichten, wäre daher schlicht, keine Geheimnisse mehr zu haben. Pool schrieb 1972, das größte Hemmnis für den Weltfrieden seien Geheimnisse. Könnte man ein System aufbauen, in dem die Gedanken und Motive politischer Führer und ganzer Bevölkerungen transparent wären, dann stünden den herrschende Elite endlich jene Informationen zur Verfügung, die sie zur ordentlichen Verwaltung der Gesellschaft braucht.
Das alles verstand Pool durchaus utopisch – immer noch besser, als Menschen zu bombardieren! Wenn man sie so manipulieren kann, dass sie keine Kalaschnikows zur Hand nehmen, muss man sie nachher auch nicht mit Bomben, Gas und Napalm bewerfen. Die Manipulation war für ihn einfach das bessere der beiden Systeme.
Jutel: Inwiefern spiegelt unsere Hyperaktivität online – wo wir dauernd Spaß haben wollen oder einfach nur die Timeline noch einmal runterscrollen wie bei einem einarmigen Banditen – die Imperative, aber auch das Scheitern dieses Prinzips der totalen Information? Man kann heute zwar die Pathologien und Eigenheiten jedes Einzelnen berechnen, aber die Information scheitert als Konzept, oder?
Levine: Ja, denn wenn deine Ausgangshypothese falsch ist, wird das Ergebnis, egal welche Information man in das System einspeist, gleichfalls falsch sein.
Die Schlussfolgerung ist, dass die Prämisse „mehr Information bedeutet bessere Verwaltung“ oder gar eine bessere Gesellschaft, einfach nicht stimmt. Viele dieser kybernetischen Modelle, die den ManagerInnen bessere Informationen über die Welt liefern sollen, haben blinde Flecken oder können leicht manipuliert werden. Trotzdem glauben die Menschen, die diese Systeme verwenden, die totale Kontrolle über alles zu haben.
Genau das passierte auch Hillary Clinton. Ihr Team hatte die besten Köpfe in Sachen Datenmodellierung, und bis zum bitteren Ende sagten ihnen die Zahlen, dass alles bestens sei. So gut, dass sie nicht mehr mit der wirklichen Welt Kontakt aufnahmen, sondern nur noch mit ihrem Modell. Sie reagierten nicht auf die Wählerschaft, sondern auf ihre eigene Vorstellung der Wählerschaft. Und darin lagen sie grundlegend falsch. Die Theorie, dass man die Welt umso besser versteht, je mehr Daten man über sie hat, ist schlichtweg unrichtig. Daten sind immer nur eine Repräsentation der Welt, die ihrerseits von spezifischen Annahmen und Werten geformt ist.
Kommen wir zum Vietnamkrieg zurück. Die Vietkong wussten, was los war, und sahen die abgeworfenen Sensoren. Also konnten sie das System austricksen. Sie erzeugten Vibrationen, indem sie Lastwägen ohne Soldaten in menschenleere Waldstücke fuhren, damit die Amerikaner ihre Luftschläge dorthin lenkten. Die eigentlichen Truppenkonvois aber kamen durch. Das System wurde also manipuliert, während die amerikanischen Planer noch glaubten, es würde perfekt funktionieren und der Feind würde vernichtet. In Wahrheit bombardierten sie den leeren Dschungel.
Eines der erfreulicheren Ergebnisse meiner Recherchen war, dass sowohl BefürworterInnen als auch GegnerInnen die Wirksamkeit dieser Netzwerke überschätzen. Nehmen wir Donald Trump und Cambridge Analytica. Gerade Leute, die Angst vor Trump als Präsident haben, wollen unbedingt an Cambridge Analytica glauben, deren Machenschaften angeblich den Wahlausgang erklären. Sie projizieren ihre Ängste auf eine Firma, die angeblich mit ein paar Facebook-Postings aus den amerikanischen WählerInnen Zombies gemacht hat.
Jutel: Wenn das Netzwerk eine gesellschaftliche Realität erzeugt, die wir nicht mögen, dann haben wir immer den Eindruck, die Gesellschaft wäre von einem Alien oder einem Virus befallen worden. Darin erinnert es an den extremen Antikommunismus von einst.
Levine: Das ist genau das, was Facebook seinen WerbekundInnen über sich einreden möchte! Wenn man die Wählerschaft überzeugen kann, jemanden wie Trump zu wählen, nur weil man ihre Facebook-Profile hackt und ihnen ein paar Zielgruppenwerbungen einspielt, dann muss man ja als Werbefirma oder politische Partei alles auf Facebook setzen. So mächtig wäre Facebook gerne! Wenn man sich dermaßen vor Cambridge Analytica verbeugt, nützt man letztlich Facebook. Man verkauft damit Facebook-Produkte, weil es anscheinend nur um den Zugang zu den Facebook-NutzerInnen geht, die man analysiert und dann mit Zielgruppenwerbung bombardiert. Gerade die GegnerInnen von Facebook glauben, dass Facebook mehr Wirkung hat, als es in Wahrheit hat.
Jutel: Wired veröffentlichte erst unlängst einen interessanten Artikel, wonach Trump angeblich die Anzeigen auf Facebook billiger als Clinton bekam, weil der Content, den er generiert, mehr Traffic erzeugt. Trump-WählerInnen toben sich im Internet ja immer ziemlich aus. Fördert Facebook also Hass und Neid und damit die dunklere Seite der Politik?
Levine: Ja, sicher, Facebook will, dass die Leute möglichst lange vor dem Schirm kleben. Wut, Hass und Empörung sind gute Katalysatoren, dass sie auch wirklich online bleiben. Davon kann ich als Twitter-User selber ein Lied singen! Wenn einem ein Thema emotional nahegeht, bleibt man dran.
Was Sie beschreiben, gilt aber nicht nur für Facebook. Auch die Kabelsender schenkten Trump Sendezeit, weil sie jede noch so lächerliche Meldung von ihm berichteten, nur um Quote zu machen. Wie bei Facebook geht es schließlich auch im Fernsehen immer um die Quote, weil danach die Werbepreise berechnet werden.
Aber das sind Details. Entscheidender ist, dass wir das Internet als Cloud auffassen, die außerhalb der materiellen Welt existiert. In Wirklichkeit aber ist das Internet Privateigentum, und wir als NutzerInnen haben daher darin auch keine Rechte. Wir existieren in Datenzentren und Kabeln, die den Großkonzernen gehören. Und doch haben wir in diesem Raum keinerlei Rechte, ja nicht einmal das Recht auf Zutritt. Die Konzerne bestimmen die Regeln, und wir haben nicht einmal ein Einspruchsrecht. Um es für Linke, die über das Internet nachdenken, deutlich zu sagen: Das Internet ist toxisch, es ist ein Werkzeug des Kapitals, das unser Leben damit noch besser kontrollieren kann.
Jutel: Welche ganzheitliche zivilgesellschaftliche Haltung sollte die Linke zu dieser oligarchischen Macht einnehmen?
Levine: Das ist vermutlich die schwierigste Frage unserer Zeit. Man kann das Internet ja nicht reformieren, ohne dabei das größere kulturelle Umfeld zu beachten. Das Netz spiegelt unsere Werte und unsere politische Kultur. Es wird deshalb von Großkonzernen, Geheimdiensten und Schnüfflern beherrscht, weil diese unsere Gesellschaften ganz allgemein beherrschen.
Man kann mit der Reform daher nicht einfach beim Internet beginnen, sondern muss den Hebel tiefer ansetzen – in der Politik, in der Kultur. Dabei ist unsere Vorstellung von Politik heute immer noch recht primitiv, stets denken wir: „Da muss man regulieren, dort braucht’s neue Gesetze.“ Wir sollten aber nicht bei der Gesetzgebung beginnen, sondern mit Prinzipiellem. Was bedeutet es eigentlich, wenn eine demokratische Gesellschaft solche Kommunikationstechnologien besitzt? Wie können diese dazu beitragen, eine demokratischere Welt zu schaffen? Wie kann die demokratische Welt diese Technologien kontrollieren? Wie kommen wir endlich aus der Defensive? Und was heißt es, aktiv zu sein? Kurz, wir brauchen eine politische Kultur, die festlegt, was die Technik für uns leisten soll.
Alles, was je über die angebliche demokratische Natur des Internets gesagt wurde, waren nicht mehr Werbesprüche. Das Internet als demokratische Technologie zu verkaufen, wenn es doch im Eigentum von Großkonzernen steht, ist schlichtweg lächerlich. Die einzige Lösung, die ich für dieses Problem sehe, besteht darin, dass wir uns zuerst ausmalen müssen, welche Gesellschaft wir eigentlich wollen. Erst dann können wir definieren, welche Rolle die Technologie zu ihrem Nutzen spielen kann.
Übersetzung aus dem Englischen: Thomas Raab
Yasha Levine, Surveillance Valley. The Secret Military History of the Internet. Public Affairs 2018.
Im tiefen Tal der Cyberüberwachung
Interview mit dem Autor Yasha Levine über die militärischen Ursprünge des Internets und die Probleme seiner demokratiepolitischen Zurichtung
Olivier Jutel
Yasha Levine ist Autor des beim Verlag Public Affairs erschienenen Buchs Surveillance Valley. Als investigativer Journalist und Gründungsredakteur von The eXile veröffentlichte er in NSFW Corp, Pando Daily, The Baffler, Alternet sowie The Nation. Seit Langem verfolgt Levine das Ineinandergreifen von Überwachung, der hyperliberalen Ideologie des „Cyberlibertarianismus“ und der Ausbildung neuer Oligarchien. Darüber hinaus zählt er zu jenen Whistleblowern, die die Rolle des Tor-Projekts für die „sanft-militärischen“ Aktivitäten der USA enthüllt haben.
Olivier Jutel: Wie ist Ihr Buch und seine Hauptthese, dass das Internet im Wesentlichen eine Überwachungsmaschine ist, rezipiert worden?
Yasha Levine: Mein Buch ist zu einem wirklich guten Zeitpunkt erschienen, nämlich genau als sich viele der „dunklen Seite“ des Internets bewusst wurden. Vor Trump war noch alles eitel Wonne, sogar die Manipulation durch Facebook war super, weil sie ja von Obama kam. Surveillance Valley erschien zwei Monate vor dem Skandal von Cambridge Analytica. Alles, was ich schreibe, ist somit nur eine Art Vorwort dazu, wie wesentlich die Manipulation privater Daten für unsere Politik und Wirtschaft inzwischen ist. Im Grunde war das immer schon der Zweck des Internets, seit vor 50 Jahren das ARPANET aufgebaut wurde. Ich hoffe, dass das Buch ein paar Wissenslücken schließen kann, denn die Geschichte des Internets haben wir offenbar, so seltsam es klingen mag, vergessen.
Jutel: Über das Internet wird oft wie über „die Macht“ in Star Wars geredet – so als würde es aus immateriellen Teilchen bestehen. Ihr Buch hingegen erklärt die materiellen, politischen und ideologischen Ursprünge des Netzes. Könnten Sie etwas zu den militärischen Imperativen sagen, denen es dient?
Levine: Als Erstes muss man wissen, dass das Internet als Forschungsprojekt im Zuge des Vietnamkriegs entstand. Die USA waren damals in Sorge, es könne weltweit zu derartigen Aufständen kommen. Das Internet war ein Projekt, dass dem Pentagon dabei helfen sollte, eine weltweite militärische Präsenz aufzubauen, um diese Aufstände niederzuschlagen.
Damals wurden die ersten Computersysteme gebaut, die wie das ARPANET vernetzt waren und zur Frühwarnung vor möglichen sowjetischen Nuklearschlägen dienten. Computer und Radargeräte wurden so miteinander verbunden, dass Analysten auf Bildschirmen in Tausenden Kilometern Entfernung das ganze Staatsgebiet überwachen konnten. Das war insofern neu, als alle vorigen Systeme auf Berechnungen basierten, die von Menschen durchgeführt wurden. Sobald sie automatisiert waren, entstanden ganz neue Vorstellungen von der Welt. Plötzlich konnte man den Luftraum und Tausende Kilometer Grenze von einem Computer aus überwachen. Das war in den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren. Die Grundidee bestand darin, die Computertechnik auf Schlachtfelder und in der Folge auf ganze Gesellschaften auszuweiten.
Eine der Aufgaben, denen das ARPANET in den 1960er-Jahren in Vietnam diente, bestand in der „Schlachtfeldabhörung“, wie man das nannte. Man warf Sensoren über dem Urwald ab [etwa in Gestalt von Tierexkrementen, Anm. O. J.], um damit Truppenbewegungen festzustellen, die man aus der Luft nicht sehen konnte. Diese Sensoren waren kabellos und sendeten Information an ein Kontrollzentrum, wo sie ein IBM-Computer aufnahm. Die von ihm errechneten Truppenbewegungen dienten dann zur Zielauswahl für Bombardements. Dies war der Auftakt für alle elektronischen Grenzschutzmaßnahmen, die dann in die USA rückexportiert und an der Grenze zu Mexiko eingesetzt wurden – und bis heute werden.
Das Internet entstand in diesem militärischen Zusammenhang. Es ist eine Technologie, die verschiedenartige Computernetzwerke und Datenbanken miteinander verbinden soll, die damals von null weg alle mit eigenen Netzwerk-Protokollen und eigener Hardware aufgebaut wurden. Das Internet fungiert als eine universelle Netzwerksprache zum Informationsaustausch zwischen diesen Geräten.
Jutel: Das ideologische Fundament des Internets kommt mir widersprüchlich vor. Einerseits gibt es da die antikommunistische Paranoia, andererseits den superliberalen Optimismus, der freie Informationsfluss könnte das Potenzial des Menschen erst richtig entfalten. Wie sehen Sie diesen Widerspruch?
Levine: Das sieht nur wie ein Widerspruch aus, ist aber keiner. Die Angst vor dem Kommunismus führte zum Internet und beschleunigte auch seine Weiterentwicklung. Aber nur ein winziger Kreis des Militärs glaubte wirklich, dass die linke Politik die ganze Welt einschließlich der USA erobern könnte. Nach Vietnam verschob sich der Fokus der Aufstandsbekämpfung dahin, wie man soziale Unruhen beschwichtigen kann, ohne den Menschen das geben zu müssen, was sie eigentlich wollten.
Als Hauptproblem wurde nunmehr erachtet, dass die Menschen nicht richtig verwaltet wurden – was ihre Sorgen, ihre Ungleichheit, die ungerechte Verteilung der Ressourcen betraf. Dennoch glaubte man nicht, dass Amerika vor einer ideologischen Herausforderung oder einem antikolonialen Kampf stünde, sondern dass man bloß ein verwaltungstechnisches Problem habe.
Und so wurden die Computernetzwerke, aus denen später das Internet werden sollte, und die Information, die sie übertrugen, zu sozialen Sensoren. Endlich konnte man Revolten oder auch nur Unzufriedenheit leicht aufspüren. Diese Information konnte wiederum in Computermodelle gefüttert werden, um damit die mögliche Ausbreitung bestimmten Ideen und Forderungen vorherzusagen. Und dann konnte man sagen: „Okay, die haben dieses oder jenes Problem, geben wir ihnen einfach ein bisschen von dem, was sie wollen“, oder: „Hier ist eine Revolutionsbewegung, von der wir am besten diese oder jene Zelle eliminieren sollten“.
Das Netzwerk diente also zur Verwaltung der Gesellschaft und Schaffung einer utopischen Welt, in der man Konflikte wegmoderieren und ganz ausmerzen konnte. Mit dieser besseren und dezenteren technokratischen Verwaltung sollte es nie mehr zu bewaffneten Konflikten kommen.
Jutel: Da muss ich unweigerlich an Hillary Clintons legendären Tweet über den Niedergang von Flint, Michigan, denken. „Komplexe soziale Probleme“ wie ethnische und ökonomische Unterdrückung sind darin in hübsche kleine Kästchen geschrieben, damit wohlmeinende TechnokratInnen dann in ihren Workshops hübsche kleine Lösungen ausbaldowern können.
Levine: Ja, und all das begann in den 1960er-Jahren. Wenn Sie schon die Demokraten erwähnen: Am MIT arbeitete einst ein gewisser Ithiel de Sola Pool, der als Sozialwissenschaftler ein Pionier der Computermodellierung war, was Umfragen und Simulationen in Wahlkämpfen betraf. Bei seiner Präsidentschaftskampagne 1960 verließ sich John F. Kennedy auf Pool, dessen Modelle den Zuschnitt von Botschaften und Wähleransprache bestimmten. Interessant ist auch, dass Pool später eine wichtige Rolle beim ersten Überwachungsprojekt im ARPANET spielte, im Zuge dessen in den frühen 1970er-Jahren Daten von Millionen KriegsgegnerInnen verarbeitet wurden.
Pool glaubte außerdem, das Problem internationaler wie nationaler Konflikte läge darin, dass die Planenden in den Regierungen und Konzernchefetagen einfach nicht genügend Information hätten. Teile der Welt wären einfach zu undurchsichtig für sie. Eine Chance, um Konflikte zu überwinden und ein perfektes System zu errichten, wäre daher schlicht, keine Geheimnisse mehr zu haben. Pool schrieb 1972, das größte Hemmnis für den Weltfrieden seien Geheimnisse. Könnte man ein System aufbauen, in dem die Gedanken und Motive politischer Führer und ganzer Bevölkerungen transparent wären, dann stünden den herrschende Elite endlich jene Informationen zur Verfügung, die sie zur ordentlichen Verwaltung der Gesellschaft braucht.
Das alles verstand Pool durchaus utopisch – immer noch besser, als Menschen zu bombardieren! Wenn man sie so manipulieren kann, dass sie keine Kalaschnikows zur Hand nehmen, muss man sie nachher auch nicht mit Bomben, Gas und Napalm bewerfen. Die Manipulation war für ihn einfach das bessere der beiden Systeme.
Jutel: Inwiefern spiegelt unsere Hyperaktivität online – wo wir dauernd Spaß haben wollen oder einfach nur die Timeline noch einmal runterscrollen wie bei einem einarmigen Banditen – die Imperative, aber auch das Scheitern dieses Prinzips der totalen Information? Man kann heute zwar die Pathologien und Eigenheiten jedes Einzelnen berechnen, aber die Information scheitert als Konzept, oder?
Levine: Ja, denn wenn deine Ausgangshypothese falsch ist, wird das Ergebnis, egal welche Information man in das System einspeist, gleichfalls falsch sein.
Die Schlussfolgerung ist, dass die Prämisse „mehr Information bedeutet bessere Verwaltung“ oder gar eine bessere Gesellschaft, einfach nicht stimmt. Viele dieser kybernetischen Modelle, die den ManagerInnen bessere Informationen über die Welt liefern sollen, haben blinde Flecken oder können leicht manipuliert werden. Trotzdem glauben die Menschen, die diese Systeme verwenden, die totale Kontrolle über alles zu haben.
Genau das passierte auch Hillary Clinton. Ihr Team hatte die besten Köpfe in Sachen Datenmodellierung, und bis zum bitteren Ende sagten ihnen die Zahlen, dass alles bestens sei. So gut, dass sie nicht mehr mit der wirklichen Welt Kontakt aufnahmen, sondern nur noch mit ihrem Modell. Sie reagierten nicht auf die Wählerschaft, sondern auf ihre eigene Vorstellung der Wählerschaft. Und darin lagen sie grundlegend falsch. Die Theorie, dass man die Welt umso besser versteht, je mehr Daten man über sie hat, ist schlichtweg unrichtig. Daten sind immer nur eine Repräsentation der Welt, die ihrerseits von spezifischen Annahmen und Werten geformt ist.
Kommen wir zum Vietnamkrieg zurück. Die Vietkong wussten, was los war, und sahen die abgeworfenen Sensoren. Also konnten sie das System austricksen. Sie erzeugten Vibrationen, indem sie Lastwägen ohne Soldaten in menschenleere Waldstücke fuhren, damit die Amerikaner ihre Luftschläge dorthin lenkten. Die eigentlichen Truppenkonvois aber kamen durch. Das System wurde also manipuliert, während die amerikanischen Planer noch glaubten, es würde perfekt funktionieren und der Feind würde vernichtet. In Wahrheit bombardierten sie den leeren Dschungel.
Eines der erfreulicheren Ergebnisse meiner Recherchen war, dass sowohl BefürworterInnen als auch GegnerInnen die Wirksamkeit dieser Netzwerke überschätzen. Nehmen wir Donald Trump und Cambridge Analytica. Gerade Leute, die Angst vor Trump als Präsident haben, wollen unbedingt an Cambridge Analytica glauben, deren Machenschaften angeblich den Wahlausgang erklären. Sie projizieren ihre Ängste auf eine Firma, die angeblich mit ein paar Facebook-Postings aus den amerikanischen WählerInnen Zombies gemacht hat.
Jutel: Wenn das Netzwerk eine gesellschaftliche Realität erzeugt, die wir nicht mögen, dann haben wir immer den Eindruck, die Gesellschaft wäre von einem Alien oder einem Virus befallen worden. Darin erinnert es an den extremen Antikommunismus von einst.
Levine: Das ist genau das, was Facebook seinen WerbekundInnen über sich einreden möchte! Wenn man die Wählerschaft überzeugen kann, jemanden wie Trump zu wählen, nur weil man ihre Facebook-Profile hackt und ihnen ein paar Zielgruppenwerbungen einspielt, dann muss man ja als Werbefirma oder politische Partei alles auf Facebook setzen. So mächtig wäre Facebook gerne! Wenn man sich dermaßen vor Cambridge Analytica verbeugt, nützt man letztlich Facebook. Man verkauft damit Facebook-Produkte, weil es anscheinend nur um den Zugang zu den Facebook-NutzerInnen geht, die man analysiert und dann mit Zielgruppenwerbung bombardiert. Gerade die GegnerInnen von Facebook glauben, dass Facebook mehr Wirkung hat, als es in Wahrheit hat.
Jutel: Wired veröffentlichte erst unlängst einen interessanten Artikel, wonach Trump angeblich die Anzeigen auf Facebook billiger als Clinton bekam, weil der Content, den er generiert, mehr Traffic erzeugt. Trump-WählerInnen toben sich im Internet ja immer ziemlich aus. Fördert Facebook also Hass und Neid und damit die dunklere Seite der Politik?
Levine: Ja, sicher, Facebook will, dass die Leute möglichst lange vor dem Schirm kleben. Wut, Hass und Empörung sind gute Katalysatoren, dass sie auch wirklich online bleiben. Davon kann ich als Twitter-User selber ein Lied singen! Wenn einem ein Thema emotional nahegeht, bleibt man dran.
Was Sie beschreiben, gilt aber nicht nur für Facebook. Auch die Kabelsender schenkten Trump Sendezeit, weil sie jede noch so lächerliche Meldung von ihm berichteten, nur um Quote zu machen. Wie bei Facebook geht es schließlich auch im Fernsehen immer um die Quote, weil danach die Werbepreise berechnet werden.
Aber das sind Details. Entscheidender ist, dass wir das Internet als Cloud auffassen, die außerhalb der materiellen Welt existiert. In Wirklichkeit aber ist das Internet Privateigentum, und wir als NutzerInnen haben daher darin auch keine Rechte. Wir existieren in Datenzentren und Kabeln, die den Großkonzernen gehören. Und doch haben wir in diesem Raum keinerlei Rechte, ja nicht einmal das Recht auf Zutritt. Die Konzerne bestimmen die Regeln, und wir haben nicht einmal ein Einspruchsrecht. Um es für Linke, die über das Internet nachdenken, deutlich zu sagen: Das Internet ist toxisch, es ist ein Werkzeug des Kapitals, das unser Leben damit noch besser kontrollieren kann.
Jutel: Welche ganzheitliche zivilgesellschaftliche Haltung sollte die Linke zu dieser oligarchischen Macht einnehmen?
Levine: Das ist vermutlich die schwierigste Frage unserer Zeit. Man kann das Internet ja nicht reformieren, ohne dabei das größere kulturelle Umfeld zu beachten. Das Netz spiegelt unsere Werte und unsere politische Kultur. Es wird deshalb von Großkonzernen, Geheimdiensten und Schnüfflern beherrscht, weil diese unsere Gesellschaften ganz allgemein beherrschen.
Man kann mit der Reform daher nicht einfach beim Internet beginnen, sondern muss den Hebel tiefer ansetzen – in der Politik, in der Kultur. Dabei ist unsere Vorstellung von Politik heute immer noch recht primitiv, stets denken wir: „Da muss man regulieren, dort braucht’s neue Gesetze.“ Wir sollten aber nicht bei der Gesetzgebung beginnen, sondern mit Prinzipiellem. Was bedeutet es eigentlich, wenn eine demokratische Gesellschaft solche Kommunikationstechnologien besitzt? Wie können diese dazu beitragen, eine demokratischere Welt zu schaffen? Wie kann die demokratische Welt diese Technologien kontrollieren? Wie kommen wir endlich aus der Defensive? Und was heißt es, aktiv zu sein? Kurz, wir brauchen eine politische Kultur, die festlegt, was die Technik für uns leisten soll.
Alles, was je über die angebliche demokratische Natur des Internets gesagt wurde, waren nicht mehr Werbesprüche. Das Internet als demokratische Technologie zu verkaufen, wenn es doch im Eigentum von Großkonzernen steht, ist schlichtweg lächerlich. Die einzige Lösung, die ich für dieses Problem sehe, besteht darin, dass wir uns zuerst ausmalen müssen, welche Gesellschaft wir eigentlich wollen. Erst dann können wir definieren, welche Rolle die Technologie zu ihrem Nutzen spielen kann.
Yasha Levine, Surveillance Valley. The Secret Military History of the Internet. Public Affairs 2018.
Übersetzt von Thomas Raab