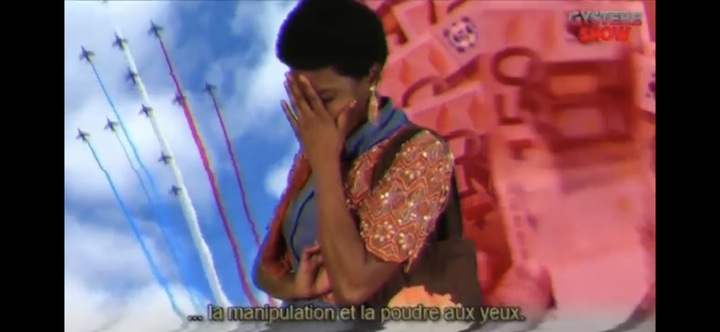Sie ist Vorkämpferin eines Feminismus im Zeichen der Dekolonisierung. Ihre Auftritte sind in der Pariser Museumswelt, die sich inzwischen viel Mühe mit dem Dekolonisieren gibt, gefürchtet: Als das Musée d’Orsay mit Le Modèle Noir ein Jahrhundert Ignoranz der Schwarzen in der französischen Kunstgeschichte korrigieren wollte, besuchte sie mit ihrem Verein Décoloniser les arts die Schau. Die Gruppe veröffentlichte danach eine beißende Analyse auf dem Nachrichtenportal „Mediapart“ und legte Schritt für Schritt die Mängel der Ausstellung offen.
Die Politologin Françoise Vergès, 1952 im 11. Arrondissement von Paris geboren, ist die Tochter der Kommunistin, feministischen Aktivistin und Ministerialbeamtin Laurence Deroin, die als Festlandfranzösin auf La Réunion lebte. Ihr Vater Paul Vergès, Gründer der Kommunistischen Partei von La Réunion, starb 2016 als Senator der französischen Republik. Mit zwei Jahren kam Françoise nach La Réunion, verließ die Insel, um in Algerien ihr Abitur zu machen, sympathisierte mit dem Unabhängigkeitskampf (ihr Onkel, der Anwalt Jacques Vergès, war dessen militanter Verteidiger). Dann reiste sie illegal in die USA, schlug sich durch, verließ das Land über Mexiko, um schließlich in Kalifornien zu studieren und in Berkeley zu promovieren. Als Universitätsprofessorin ist sie heute Mitglied des Centre for Cultural Studies am Goldsmiths College der Universität von London.
„Die Biografie erklärt nicht alles, meistens sogar gar nichts“, schreibt Vergès in ihrem 2019 erschienenen Buch Un féminisme décolonial (Paris: La fabrique; eine deutsche Übersetzung ist im Passagen Verlag geplant). Doch in ihrem Fall sei der militante Familienhintergrund wichtig. Man habe ihr beigebracht, die Herrschenden zu sehen: „Das sind Schlägertypen, Faschisten, Schurken, sie respektieren keinerlei Recht, am wenigsten das unsrige auf Existenz“, zitiert sie das familiäre Umfeld. Dann schwärmt sie vom Einmarsch Castros in Havanna, von der Nationalen Befreiungsfront in Algier: Das seien Bilder der Hoffnung gewesen. Doch noch immer unterdrücke die herrschende Klasse weiter gnadenlos jeden Widerstand.
Das liest sich heute, da Diversifikation, Vielansichtigkeit und Dekonstruktion zum Repertoire politischen Denkens gehören, wie postkommunistische Blocknostalgie, die in alten Gräben in Schwarz-Weiß-Manier weiterkämpfen will. Françoise Vergès war freilich nie auf den Barrikaden. Ihr Weg ging durch die Institutionen: von 2003 bis 2010 als wissenschaftliche Leiterin der Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise (MCUR), die sie zu einem postkolonialen Museum der Jetztzeit ausbauen wollte. Unter dem Vorwurf, ihr Vater habe sie auf den Posten gehoben, wurde das Projekt 2010 gestoppt. In Festlandfrankreich war sie von 2008 bis 2013 Vorsitzende des Nationalen Komitees für die Erinnerung und die Geschichte der Sklaverei. Nicolas Sarkozy verlieh ihr dafür 2010 den Ritterorden der Ehrenlegion.
So sehr die Autorin für ihre präzisen Analysen zu schätzen ist, so ernüchternd fällt die Lektüre der ersten Hälfte von Un féminisme décolonial aus. Mit militanter Attitüde greift sie verallgemeinernd „die Anderen“ bzw. „die Korrumpierten“ an oder verstört mit simplifizierenden Aussagen wie: „Ich stehe hier für einen dekolonialen Feminismus, dessen Ziel die Zerstörung des Rassismus ist, des Kapitalismus, des Imperialismus“. Beim Weiterlesen wird deutlich, dass Vergès mit solchen Poltergesten an eine Radikalität anschließen will, mit der Autorinnen wie Audre Lorde einst die „zweite Welle“ des Feminismus ablösten.
„Wie geht ihr damit um, dass die Frauen, die eure Häuser reinigen und auf eure Kinder aufpassen, während ihr in Vorträgen über feministische Theorie sitzt, arm und überwiegend aus Drittweltländern sind?“ So spießte Lorde 1983 eine Asymmetrie auf, die bis dahin übersehen worden war, vertrat vom Standpunkt schwarzer, sozial schwacher und LGBT-Personen eine kritische Sicht auf einen selbstgefälligen, weißen, bürgerlichen Feminismus. Tatsächlich wurde die einst aufständische Protestbewegung in den 1990er-Jahren friedlich, wie es Ani DiFranco 1999 auf ihrem Album Up Up Up Up Up Up ihren Eltern gegenüber zum Ausdruck brachte: „Ich möchte nur, dass ihr versteht, dass ich weiß, wofür all die Kämpfe waren, aber dass ich nicht mehr wütend bin.“ Der Feminismus diversifizierte sich spätestens seit Judith Butlers Unbehagen der Geschlechter 1990 und deren Kritik an „den totalisierenden Gesten des Feminismus“ hin in Richtung der allgemeinen Subjektkonstitution und der Machtstrukturen, die diese biopolitisch in Körper einschreiben. Damit wurden auch die Mann-Frau-Muster der Müttergeneration unterlaufen, gerieten neue Konfigurationen von Dominanz ausgehend von der eigenen Geschichte ins Visier, binären Oppositionen wohltuend abhold. Gesellschaftskritik, fest in Cultural Studies und postkolonialer Kritik verankert, wurde zur „dritten Welle“ des Feminismus.
Françoise Vergès erzählt diese Geschichte anders, sieht kapitalistisch-zivilisatorische Feministinnen auf der einen, ausgebeutet-rassifizierte auf der anderen Seite. Das mag in Frankreich stimmen, wo frau sich auf Simone de Beauvoir berufend „feminin, nicht feministisch“ mit hitzköpfigem Feminismus nicht die Karriere versauen will. Dann kam 2017 #BalanceTonPorc, die französische Version der #MeToo-Bewegung, worauf die Kolumnen von Catherine Deneuve, Ingrid Caven und Catherine Millet folgten, die gern an den Hintern gefasst werden und es skandalös finden, dass Männer „nur für einen gestohlenen Kuss“ aus dem Amt gejagt würden.
Françoise Verges zitiert das auf den ersten Seiten ihres Buchs. Nicht um sich zu empören, sondern um die Komplizenschaft derer zu denunzieren, die sich über Deneuve und Co. aufregen: Es sei ja klar, dass diejenigen, die sich von „rassifizierten“ Frauen die Wohnung putzen, die Kinder hüten oder die Kleider nähen lassen, Zeit hätten, sich dafür einzusetzen, nicht von lästigen Typen auf ihrem Karriereweg behindert zu werden. Von hier aus geißelt sie – bis hin zur Karikatur – einen „zivilisatorischen Feminismus“, der „femo-nationalistisch“ und „islamophob“ dem neoliberalen Kapitalismus in die Hände spiele.
Mit Audre Lordes Gestus scheint Vergès heute, im Kontext wachsenden Selbstbewusstseins der Afropéens, der Metropolen-BewohnerInnen mit afrikanischen Wurzeln, eine neue Bewegung radikalisieren zu wollen. Dafür erinnert sie speziell Frauen an deren historische Verankerung im militanten Widerstand. Im französischen Kontext könnte sie damit eine Übergangsfigur werden vom Feminismus der vierten Welle zu einer revolutionären Bewegung, die von der rassischen, sozialen, politischen und sexuellen Unterdrückung der Frauen ausgehend eine gesamtgesellschaftliche Umwälzung nach kommunistischem Vorbild anstrebt – bis hin zu einer, wie sie selbst mehrfach einräumt, „zweifellos verlustreichen“ Revolution. Beim Gespräch im Pariser Restaurant Le Bastille am gleichnamigen Revolutionsplatz erklärt sie bei einem Glas Rotwein, wo sie sich Widerstand wünscht, wie er aussehen könnte und wer ihn konkret verkörpert.
J. Emil Sennewald: Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben?
Françoise Vergès: Ich schreibe für die, mit denen ich in meiner politischen Arbeit spreche: Eine Arbeiterin braucht sonst ein Wörterbuch, wenn sie meine Texte lesen will. Ich schreibe für das einfache Volk, wenig gebildete Frauen, die in schlechten Jobs unterbezahlt arbeiten. Frauen, die etwas verändern wollen, denen aber Worte, Mittel fehlen. Das Buch sollte auch finanziell erschwinglich sein.
Sennewald: Wieso die Abwendung vom akademischen Diskurs, der doch weitreichenden Einfluss auf die politische Debatte hat?
Vergès: Der akademische Feminismus war sicher wichtig, aber er hat auch Verluste mit sich gebracht, hat andere gesellschaftliche Schichten ausgeschlossen. Ich wollte einen Feminismus initiieren, der wieder aktiv wirksam ist. Wenn sich heute Ivanka Trump oder Marine Le Pen als Feministinnen bezeichnen, dann stimmt etwas nicht! Es gilt, eine gewisse Dringlichkeit wiederzufinden, das Feuer wieder aufflackern zu lassen, gegen die um sich greifende Befriedung der politischen Debatte.
Sennewald: Man könnte im Frieden auch einen Gewinn des Feminismus sehen, der Rechte für die Frauen durchsetzen konnte.
Vergès: Genau darum geht es mir: Der Fortschritt stagniert, weil die dringenden gesellschaftlichen Fragen nicht mehr gestellt werden. Es muss klargemacht werden, auf wessen Kosten diese sogenannten Erfolge möglich wurden, wer für die schöne neue emanzipierte weiße Welt zahlt: rassifizierte Frauen in einem immer schmutzigeren, verseuchten, zerstörten globalen Süden. Der breite zivilisatorische Feminismus ist Komplize eines ausbeuterischen Neoliberalismus. Der dekoloniale Feminismus kann das aufzeigen, kann die Revolution wieder revolutionieren.
Sennewald: Tatsächlich sprechen Sie im Buch mehrfach von notwendigen Opfern – wollen Sie einen bewaffneten Kampf?
Vergès (zuckt mit den Schultern): Es geht doch darum, immer weiter an der Revolution zu arbeiten. Sollte es dazu kommen, gibt es unweigerlich viele Opfer. Was die Gewalt betrifft, so leben wir heute bereits inmitten von Gewalt, aber einer, die maskiert und schöngeredet wird, einer, die ausgeblendet wird zugunsten einer weißen, sauberen Welt. Was ist Gewalt in einem gewaltsamen Kontext? Die politischen Kräfte, die durch Befriedung regieren wollen, tun das, indem sie die Brutalisierung der Unterdrückung, besonders im globalen Süden, ausblenden.
Sennewald: Die Nachrichten sind voll davon …
Vergès: Was ich meine, sind strukturelle Gewalt und systemische Unterdrückung. Dazu gehört auch, unablässig die weiße Welt mit Schreckensmeldungen aus der anderen Hälfte zu versorgen, ihr ein Gegenbild zu liefern, das ihre zivilisatorischen Errungenschaften glorifiziert. Nicht die Armut hat die Zivilisation provoziert – es ist die zivilisatorische Haltung, die globale Armut verursacht, weil sie im Kern ausbeuterisch und unterdrückerisch ist.
Sennewald: Es gibt schon lange die Diskussion um die adäquaten Mittel und Ansätze wie Dekonstruktion, Subversion, Travestie. Taugt das alles nichts?
Vergès: Feminismus ist im Kern eine Revolte. Und gibt es denn andere als gewaltsame Revolten? Dekolonialer Feminismus bedeutet, die revolutionären Kämpfe zu entpatriarchalisieren. Die Feminismen dekolonialer Prägung führen einen jahrhundertealten Kampf weiter, mit dem ein Teil der Menschheit das Recht auf Existenz erhalten wollte. Allen Frauen muss möglich sein, sich darüber klar zu werden, mit zu verhandeln, was es bedeutet, Frau zu sein, wie man das leben kann. Wenn ich Arbeiterinnen von Subversion oder Travestie erzähle, verstehen die kein Wort.
Sennewald: Man könnte versuchen, es ihnen zu erklären …
Vergès: Schauen Sie: Heute haben wir es doch mit einer unsichtbaren Gewalt der Herrschenden zu tun. Sie wirkt, ohne dass diejenigen, die durch sie regiert werden, ihre unmittelbaren, grausamen Auswirkungen sehen. Die Unmöglichkeit von Sauberkeit, in der man den globalen Süden hält, ist eine Form von Gewalt. Überall bilden sich geschützte Enklaven, weil man in manchen Städten, wie in Chennai, gar nicht mehr außerhalb leben kann. In meinem Buch stelle ich die Frage: „Wer reinigt die Welt?“ Schaut man mit dieser Frage hin, wird deutlich, dass die Welt in zwei Hälften geteilt ist: in eine saubere und eine schmutzige. Und dass einige Menschen aus der schmutzigen Hälfte in die saubere dürfen, um dort zu putzen. Die Frau von La Réunion, die aus der Banlieue frühmorgens mit der Vorstadtbahn ins Stadtzentrum von Paris fährt, um Büros wieder glitzern, Luxusboutiquen wieder leuchten, Appartements wieder clean erscheinen zu lassen, sie darf in die Stadt. Ihr halbwüchsiger Junge wird als „gefährlich“ draußen gehalten. Sie allerdings ist bereits im Zentrum der Macht – es wäre ein kleiner Schritt, von den Palästen aus die Revolution zu beginnen …
Sennewald: All das ist diesen Menschen nicht bewusst?
Vergès: Teilweise, aber sie durchschauen die Zusammenhänge nicht. Deshalb trete ich für massive Bildung ein, dafür, mit den Menschen gemeinsam, wie ich schreibe „Zeit zu verbringen, um zu verstehen, wer die Gesellschaften zerschlagen und beschädigt hat, wer verantwortlich für die Verzweiflung der Jugend ist, wer für Vergewaltigungen und willkürliche Verhaftungen verantwortlich ist“. Eine solche Bewusstwerdung kann nur gemeinsam erfolgen, und sie geht nur unter gleichberechtigter Einbeziehung rassifizierter Frauen, die man bisher immer ausgeblendet hat.
Sennewald: Mit „Wer reinigt die Welt?“ weiten Sie Audre Lordes Frage auf die spätkapitalistische Welt aus, an deren Spaltung in sauber und schmutzig jene „zivilisatorischen“ Feministinnen mitschuldig seien sollen, die „ihren eigenen Rassismus“ nicht sehen. Seit über 30 Jahren diversifiziert sich die feministische Bewegung. Müsste jetzt nicht Solidarität im Vordergrund stehen?
Vergès: Es braucht Solidarität, aber man muss sich fragen mit wem. Heute kommt die verdrängte Kolonialgeschichte zurück, und ich weise laut und deutlich darauf hin, dass es eine feministische Ideologie gibt, die so tut, als sei sie als Einzige nicht Teil des Kolonialismus gewesen, als seien die Frauen immer auf der richtigen Seite gestanden. Das hat natürlich einige sehr aufgeregt. Indem dieser Feminismus Herrschaft nur als die der Männer dachte, seinen Kampf nur in der Mann-Frau-Dualität ansiedelte, hat er sich „gebleicht“, „weiß gemacht“. Heute muss sich jede Feministin fragen: In welcher Geschichte handle, von welcher Ungleichheit profitiere ich? Und umgekehrt: Was tue ich gegen Rassismus, konkret, jeden Tag?
Sennewald: Sie scheinen hier in erster Linie vom Second-Wave-Feminismus zu sprechen. Dieser wurde ab den 1980er-Jahren aber zunehmend von Positionen abgelöst, die sehr wohl die koloniale Dimension bedenken und bearbeiten.
Vergès: Zu mir kommen viele junge weiße Frauen, die auch teilnehmen an unseren dekolonialen Aktionen, und fragen mich: Was soll ich tun? Vor 20 Jahren hätte ich noch zu Erklärungen angesetzt. Heute antworte ich: Lernt selbst! Es gibt unendliche viele Texte, Bücher, Filme, Kunstwerke, all das müsst ihr selber lernen. Das ist ein langer Prozess, in dem die Kunst eine wichtige Rolle spielt, weil sie Freiräume schafft. Wir brauchen Zeit, müssen uns zurückziehen können um zu lernen. Das geht nur kollektiv, zwischen Disziplinen, Ländern, losgelöst von Institutionen. Aber, und auch das sage ich im Buch: Es sind nicht mehr diejenigen, die niemals Opfer rassistischer Gewalt wurden, die den Rahmen der Diskussion vorgeben. Und es ist nicht die Aufgabe der Rassifizierten, zu erklären, Fakten zusammenzusuchen, Beweise zu finden. Denn nichts davon ändert etwas an dem asymmetrischen Kräfteverhältnis.
Sennewald: Wenn die meisten unterdrückten Frauen befreit wären, wäre dann auch die Gesellschaft freier?
Vergès: Meine erste Frage lautet: Wie kann eine Revolution entstehen? Heute, da die Prekarität wieder als Unterdrückungsinstrument funktioniert, gibt es immer mehr Menschen, die etwas ändern wollen. Die jungen Leute stellen den Kapitalismus in seiner neuen Gestalt infrage. Wir müssen den Freiheitsbegriff wieder als Kampfbegriff definieren. Die Lügen des Neoliberalismus haben ihn genauso entleert wie der Feminismus. Es geht heute um Befreiung, nicht um Freiheit!