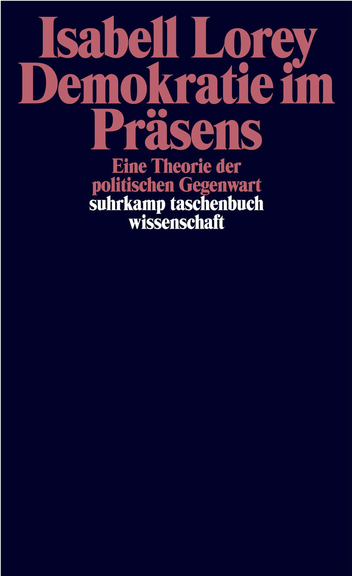Wer sich für gegenwärtige Proteste interessiert und dabei das Feld der soziologisch dominierten Protest- und Bewegungsforschung verlässt, kennt vermutlich seit geraumer Zeit Isabell Loreys Überlegungen zu jenen sozialen und politischen Bewegungen, die den Platzbesetzungen des Arabischen Frühlings folgten. Schon in ihrer Theoriebildung vor 2012 trug sie zum Verständnis von Dynamiken bei, in die Protest und widerständiges Handeln eingebettet sind und in denen sich diese im Sinne einer queerpolitischen (Selbst-)Sorge als Alternative zur „Krise der Demokratie“ artikulieren. Die hyperpräsenten Postdemokratiedebatten konsultiert sie dabei allerdings nicht, denn diese kommentierte die politische Philosophin bereits im documenta 14 Reader als gezeichnet von einer „romantisierende[n] Trauer über den Verlust des Wohlfahrtsstaats der 1970er-Jahre“, die „ignoriert, dass die soziale Absicherung [...] in der Familie patriarchal strukturiert war, basierend auf unbezahlter und abgewerteter weiblicher Sorge- und Reproduktionsarbeit im Privaten“1. Nun liegt mit Demokratie im Präsens die Ausarbeitung ihres Beitrags zum documenta-14-Katalog vor; als Buch, das sich eingehend mit emanzipatorischen Formen von Demokratie beschäftigt.
Isabell Lorey denkt und schreibt als historische Materialistin, „die nicht nur an Marx geschult ist, sondern mit Benjamin jede Fortschrittsgeschichte durchschlägt“ (S. 87). In ihrer Analyse der Versprechens- und Kreditlogik repräsentativer Demokratien untersucht sie zunächst die Prinzipien, die heutige Demokratien konstituieren: Repräsentation steht über vermeintlich ungeordneten sozialpolitischen Bewegungen. Die ideale Demokratie, die alle miteinschließt, ist aufgeschoben. Stattdessen bekommen wir das Gehetztsein einer Gegenwart zu spüren, die bis ins individuelle Zeiterleben hinein von Zukunftsversprechen und dem Abzahlen von vermeintlich erforderlichen Investitionen geprägt ist.
Gerade jetzt gilt es, sich dem verdrängten Vergangenen zuzuwenden, fordert Lorey, und die unerfüllten Wünsche und Bedürfnisse jener aufzusuchen, die vor uns regiert wurden. Ihre Suche setzt im 18. Jahrhundert ein, dessen sprunghaftes Bevölkerungswachstum neue Formen des Regierens nach sich zog. Hier, in der Herausbildung der liberalen bürgerlichen Demokratie, geht bereits die Angst vor der unberechenbaren Multitude um. Jean-Jacques Rousseau gegen den Strich bürstend, der Politik bekanntlich als Arena eines weißen männlichen Subjekts begreift, findet Lorey einen repräsentationskritischen, emanzipatorischen Funken: In seinen Beschreibungen der politischen Versammlung als Fest stellen tanzende Schwingungen etwas her, das sich für emanzipatorische Alternativen gewinnen lässt.
Als historische Materialistin ruft sie vergangene Überlegungen von Rousseau, Walter Benjamin, Jacques Derrida und Michel Foucault auf und aktualisiert sie im Kontakt mit Gefährt*innen ihrer Jetztzeit, etwa Maurizio Lazzarato, Antonio Negri, Jean-Luc Nancy, Denise Ferreira da Silva, Stefano Harvey/Fred Moten und den Precarias a la deriva. Gemeinsam erreichen ihre analytischen Skalpelle jene Splitter, die tief im gesellschaftlichen Gefüge sitzen: normativ-binäre Verkapselungen, die Affektives von Souveränität, Singuläres vom Allgemeinen, Soziales vom Politischen trennen. Sorgsam das Bereits-Gedachte wendend, schält Lorey ihren Vorschlag heraus: Wenn Demokratie ausgehend von den aus ihr verdrängten Fürsorgepraxen konzipiert wird, dann ergibt sich eine infinite, radikale Gegenwartsbezogenheit, die eine neue „präsentische“ Demokratie hervorbringt. In ihr muss Gegenwart nicht erst für den dauerhaften Gebrauch zugerichtet werden, denn in ihrem Andauern, in ihren vielfältigen durées, kann die Jetztzeit lustvoll gestaltet werden. Und das ist genauso unaufschiebbar wie die Sorge, die wir einander schulden. Nach Judith Butlers Betonung des Unterstützungsbedarfs, den alle Körper in je eigener Weise haben, macht Isabell Lorey deutlich, dass Sorge niemals auf identifizierbare Personengruppen oder Dinge begrenzt sein kann.
Im Unterschied zum Gros der politischen Theoriebildung sucht sie herauszutreten aus einem in diesem Feld üblichen Denken, das sich (bewusst oder unbewusst) in den Dienst des (Selbst-)Regierens stellt. In ihrem Menschenbild, das sie sehr transparent vermittelt, traut Lorey der Vielfalt möglicher Subjektivitäten durchaus zu, gut für sich sorgen zu können. Immer wieder suchen ihre Denkbewegungen die Nähe ungefügiger Protestpraxen, etwa der Precarias a la deriva, deren „In-Bewegung-bleiben“ sie schon in früheren Büchern beschäftigte und von deren Artikulationen sie sich begrifflich anstecken lässt.
Das Buch öffnet mannigfaltige Anschlüsse für neue Tauchgänge in die Vergangenheiten und Gegenwarten protestierender Praxen. Für Lorey (und nach Eve Kosofsky Sedgwick) kommt es dabei darauf an, die Aufmerksamkeit auf Inkonsistenzen zu richten. Über die demokratietheoretischen Implikationen hinaus lädt das Buch auch dazu ein, sich das eigene Denken und Tun in Ruhe anzuschauen und zu fragen, welche Splitter aus normativen Raum-Zeitlichkeiten mitreisen und die eigene Beweglichkeit prägen.
1 Isabell Lorey, Präsentische Demokratie, in: Quinn Latimer/Adam Szymczyk (Hg.), Der documenta 14 Reader. München 2017, S. 174.